Nordhausens erste Blütezeit unter der Herrschaft der Geschlechter
|
Kapitel 4.
Nordhausens erste Blütezeit
unter der Herrschaft der Geschlechter.
Am Tage seiner Abreise von Erfurt, am 1. November 1290, hatte Rudolf von Habsburg den Nordhäuser Bürgern eine Urkunde von weittragender Bedeutung ausgestellt. Diese Urkunde umschrieb die Rechte der Stadt genau und wurde deshalb in Ergänzung des königlichen Willensaktes vom Jahr 1220 die Grundlage für die Stellung Nordhausens innerhalb des Reiches bis zum Verluste seiner Reichsfreiheit im Jahre 1802. Drei Bestimmungen in diesem Privileg sind für die weitere Entwicklung des Rates und der städtischen Freiheiten besonders wichtig: 1.) Die Reichsbeamten sollen der Stadt Nordhausen gestatten, sich ihrer Rechte zu erfreuen; 2.) keiner darf die Nordhäuser Bürger außerhalb der Stadt vor ein Landgericht laden; 3.) Wenn die Stadt Nordhausen einen Rechtshandel hat, sollen zwei ihrer Ratsleute, Syndici oder Prokuratoren, die Gemeinde vertreten.[1] Damit hatte die Stadt Nordhausen ihre Autonomie erlangt, und der Rat der Stadt hatte freie Bahn für seine Betätigung in allen städtischen Angelegenheiten. Nach diesem Privileg durfte die Stadt Nordhausen sich eigene Statuten geben, die Reichsbeamten, Vogt und Schultheiß, hatten sich nicht dareinzumengen. Daß diese städtische Gesetzgebung vor den Rechten des Schultheißen, besonders wo diese im Schultheißengericht Handel und Wandel der Stadt berührten, nicht halt machen würde, daß diese bürgerlichen Satzungen sich selbst Eingriffe in die hohe Gerichtsbarkeit des Vogts erlauben würden, war vorauszusehen, da das Privilegium keinerlei Einschränkungen vorsah, sondern ganz allgemein gehalten war. Dieser Bewegung zur völligen Freiheit hin war das zweite angeführte Privileg ferner dadurch förderlich, daß es Nordhausen ausdrücklich die eigene Gerichtsbarkeit verlieh, von der aus an kein Gericht eines Landesfürsten, sondern nur an das königliche Gericht appelliert werden konnte. Nordhausen bekam seine eigene niedere und hohe Gerichtsbarkeit. Jener stand noch der Schultheiß, dieser der Vogt vor, doch die Beisitzer waren Nordhäuser Bürger und Ratsherren allein; der Rat mußte schließlich den Ausschlag beim Gerichtsverfahren geben und die Beamten der Aufsichtsbehörde zu bloß äußerlichen Repräsentanten der Staatsgewalt und zu Empfängern der festgesetzten Gebühren herabdrücken. Das dritte der angeführten Privilegien aber bedeutete nichts anderes, als daß Nordhausen ein Staat wie jeder andere war unter eigenem Regiment, der auf gleichem Fuße mit anderen Mächten des deutschen Reiches verkehren und seine Händel selber austragen durfte. Der Rat hatte damit die Vertretung der Stadt nach außen hin allein in seine Hand bekommen und übernahm auch das Kriegs- und Befestigungswesen der Stadt. Man kann nicht ohne weiteres urteilen, daß die Autonomie der einzelnen Teilgewalten im deutschen Vaterland zu dessen Unsegen gewesen sei. Sie hätte zum Segen werden können. Denn genau so wie heute die kommunale Selbstverwaltung für das ganze deutsche Volk im höchsten Maße ersprießlich ist, da sie jeden einzelnen zur Mitarbeit und Mitverantwortung erzieht und reichstes Regen und Streben erweckt, genau so hätte auch damals im Mittelalter diese Auflokkerung wirken können. Daß sie zur Zersplitterung führte und dadurch Deutschland zum Verderben wurde, lag nicht daran, daß den einzelnen Teilen zuviel Macht und zuviel Freiheit gewährt wurde, sondern daran, daß die Spitze zu wenig Macht und zu wenig Freiheit behielt. Starke Zentralgewalt und starke Teilgewalt schließen einander durchaus nicht aus. So hätte z. B. 1290 Nordhausen ohne Schaden des Reiches alle oben angeführten Rechte bekommen können, wenn nur den Reichsbeamten die nötige Aufsichtsgewalt und die nötige Macht, dem Spruche des Reiches Geltung zu verschaffen, gesichert geblieben wäre. Doch scheint dem Deutschen, nicht nur jener Zeit, sondern auch heute, die Fähigkeit zu fehlen, gerecht abzumessen, was dem einzelnen zusteht und was dem Ganzen gebührt. Haben die einzelnen Teile gewisse Rechte erhalten, so suchen sie dieselben auf Kosten des Ganzen ohne Maß zu erweitern, und hat sich das Reich seine Rechte gesichert, so sucht es dieselben auszubauen auf Kosten der Sonderart des einzelnen Gebildes. Am Ausgang des 13. Jahrhunderts war jedenfalls die Zuständigkeit der Teilgewalten schon derart, daß es früher oder später zum gänzlichen Verfall der Zentralgewalt kommen mußte. Auch das Prinzip des Wahlkönigtums hatte sich gänzlich durchgesetzt. Neid und Gewinnsucht der Fürsten verhinderten die Wahl eines machtvollen Herrschers, und die auf ihre Rechte so sehr pochenden Teile des Reiches kamen gerade durch ihre zu große Selbständigkeit selbst in Gefahr, da kein König da war, der „nie stirbt..., der dem Schwachen beisteht und den Bösen schreckt, der den Neid nicht kennet, denn er ist der Größte“. Auch Nordhausen kam bald nach dem Tode Rudolfs in die Lage zu spüren, was es heißt, wenn der König nicht „der größte“ ist, sondern nur um seiner selbst willen danach strebt, „der größte“ zu werden. Die Kurfürsten hatten aus Eigennutz nicht Rudolfs mächtigen Sohn Albrecht zum König gewählt, sondern Adolf, Grafen von Nassau. Ohne rechtes Ansehen und ohne eigene Macht, suchte dieser alsbald sein königliches Amt dazu auszunutzen, sich eine Hausmacht zu schaffen. Der Kampf, der um die Lande der Wettiner, Meißen und Thüringen, ging, berührte auch Nordhausen aufs empfindlichste. Albrecht der Entartete von Thüringen, ein Mann, der in seltsamster Weise und ohne jedes Gefühl für die eigene Ehre oder die seines Hauses nur dem Augenblicke lebte, hatte an Adolf die Erbfolge in Thüringen verkauft ohne Rücksicht auf seine beiden Söhne Friedrich und Diezmann. Diese aber verwahrten sich sowohl gegen den Verkauf wie auch gegen die Einziehung Meißens durch den König, auf das sie berechtigte Ansprüche hatten. So kam es zum Kriege, der in den Jahren 1294-1296 eine fürchterliche Geißel für Thüringen werden sollte. Adolf drang in Thüringen ein, um sich mit Waffengewalt des Landes zu bemächtigen. Im September und Oktober 1294 verwüstete er zunächst die Umgebung von Eisleben, dann das mittlere Thüringen um Erfurt herum. Die Thüringer Adligen hielten es fast sämtlich mit den ritterlichen Söhnen des entarteten Albrecht und scharten sich zur Abwehr zusammen. Nur Dietrich II. von Honstein scheint sich dem Gefolge des Königs angeschlossen zu haben; doch soll er den König ernstlich wegen des furchtbaren Treibens der königlichen Raubscharen zur Rede gestellt, aber nur die Antwort erhalten haben: „Ich kann meine Krieger nicht im Schubsacke bei mir führen.“ Ende Oktober kehrte Adolf ins Meißensche zurück, wandte sich gegen Ende des Jahres aber nochmals gen Norden und erschien im Dezember in den Gauen des südlichen Harzvorlandes. Es war ein außerordentlich kalter Winter. Adolf selbst quartierte sich in Nordhausen ein, seine wüsten Mannen machten es sich in den umliegenden Dörfern bequem. Hier schwelgten sie im Haus und am Herd, lagen auf der Bank und im Bett. Je kleiner die Ortschaften und je einsamer gelegen, desto ungestörter konnten die königlichen Heerscharen ihr frevelhaftes Spiel mit den Bauern treiben. Karl Meyer wird recht haben, daß damals in nächster Umgebung Nordhausens die Ortschaften Rossungen, Gumprechtrode, Niedersalza, Girbuchsrode und Barbararode eingingen, weil die Bauern, soweit sie nicht erschlagen wurden, aus ihren Gehöften nach Nordhausen flüchteten. Hier hielt unterdessen König Adolf Hof und ließ sich’s wohl sein auf Kosten der Bürger. In seinem Gefolge befanden sich der Erzbischof von Magdeburg, der Bischof von Merseburg und die Markgrafen von Brandenburg. Die Herzöge Heinrich und Albrecht von Braunschweig trafen während des Aufenthaltes des Königs in Nordhausen ein. Damals war es auch, wo Adolf von Nassau mit dem gepfeilten Otto IV. von Brandenburg, der gewisse Anrechte auf Thüringen hatte, einig ward. Am 9. Januar wandte sich der König nach Mühlhausen, um hier den Bürgern ebenso auf der Tasche zu liegen; doch traten die Mühlhäuser etwas kräftiger gegen die zuchtlosen Scharen auf, so daß Adolf alsbald einen recht kläglichen und unrühmlichen Rückzug antreten mußte.[2] So nahm König Adolf für diesmal Abschied aus Nordthüringen und von Nordhausen. Ein trauriger König schied, und ein trauriger Aufenthalt war zu Ende, und vielleicht hat der Himmel die Gebete der Bürger, die unterm Sprechen wohl zum Fluche wurden, erhört: Kein erwählter Römischer König hat seitdem jemals wieder den Fuß auf Nordhäuser Boden gesetzt. In den ersten Tagen des Januar 1295 war es das letztemal, daß ein König des alten Reiches in Nordhausens Mauern weilte. Die Luxemburger und Habsburger beschränkten sich später auf Süd- und Westdeutschland. Die Schaffung einer Residenz und die verbesserten Verkehrsmittel machten nach und nach ein Umherziehen des königlichen Hofhaltes überflüssig. Die unmittelbare persönliche Berührung der Könige mit allen deutschen Volksstämmen hörte auf. Viel nachhaltiger als das schnell vorbeiziehende Ungewitter war für die Reichsstädte Nordhausen und Mühlhausen, daß der ewig geldbedürftige König sie verpfändete, um zu Geld zu kommen. Und zum größten Schaden der Städte fand dieses böse Beispiel bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts hinein getreuliche Nachahmung bei Adolfs Nachfolgern auf Deutschlands Thron, die ebenso goldhungrig waren wie er. Denn die einflußlosen Fürsten, die zu Königen gewählt wurden, mußten sich erst die nötigen Mittel für ihre Politik von ihren Untertanen erpressen. Bei einer solchen Einstellung hätte auch die Reichsstadt Nordhausen mehrfach beinah ihre Reichsfreiheit verloren. Um zu Geld zu kommen oder um Verbindlichkeiten einzulösen, verpfändeten sie die Kaiser des öfteren, und jedesmal waren solche Operationen für die Stadt, die ihre Freiheit behalten wollte, mit größten Opfern verbunden. So wurde die Stadt zusammen mit Mühlhausen dafür, daß Erzbischof Gerhardt von Mainz für die Wahl Adolfs von Nassau eingetreten war, dem Mainzer versprochen. Doch kam es nicht zu der Auslieferung, sondern am 4. Oktober 1294 verpfändete Adolf von Nassau die Stadt an Albrecht von Thüringen. Dasselbe Schicksal erduldete Nordhausen nochmals am 7. Mai 1323, wo Ludwig der Baier es abermals an Thüringen-Meißen verpfändete. Dennoch wurde Nordhausen nie eine thüringische Landstadt. Jedesmal übernahm es für den König namhafte Zahlungen, löste sich selbst damit aus und blieb beim Reiche. Das erste Mal dauerte es mehr als 10 Jahre, von 1294-1305, ehe sich Landgraf Albrecht von Thüringen für befriedigt erklärte; erst am 7. März 1305 bezeugte er auf der Wartburg, daß Nordhausen alles bezahlt habe, was der Kaiser ihm schuldig gewesen sei. In diesen Zeiten der Bruderkämpfe war es nicht einmal vorteilhaft, nur Freie Reichsstadt zu sein ohne einen Rückhalt als den an einem schwachen und mit einem Nebenbuhler im Streite liegenden Kaiser. Besonders die mächtigen Honsteiner wurden der Stadt wieder und wieder gefährlich. Deshalb bestellte auf ihre Bitten am 5. Juli 1313 Kaiser Heinrich VII. zu Pisa den Brandenburger Heinrich von Landsberg zum „Richter und Verteidiger“ für Nordhausen. Doch scheint dieser einmalige, von einem todkranken Kaiser gegebene Befehl kaum von einiger Tragweite geworden zu sein; und da 1320 die Askanier in Brandenburg ohnedies ausstarben, so verliert diese Verbindung Nordhausens mit Brandenburg für die Stadt jede Bedeutung. Im Gegenteil, kurz darauf kam die Reichsstadt durch König Ludwig den Baier dadurch in neue Bedrängnis, daß dieser sie sowohl wie Mühlhausen an den Markgrafen Friedrich von Meißen verpfändete. Ludwig hatte dem Markgrafen seine Tochter Mechthild verlobt und ihr als Mitgift 10.000 Mark Silbers versprochen, für die die beiden Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen aufkommen sollten. So wurde also Nordhausen 1323 abermals verschachert, und erst 10 Jahre später, im Jahre 1333, konnte die Stadt durch Zahlung von 3000 Mark Silber ihre Unabhängigkeit wiedererlangen. Doch hatte diese zweite Verpfändung eine tiefe Wunde hinterlassen, indem sie die Grundlage dafür wurde, daß seit den vierziger Jahren des 14. Jahrhunderts Thüringen-Meißen und damit später Sachsen die Schutzherrlichkeit und das Schulzenamt endgültig über Nordhausen zugesprochen erhielten.[3] Im Jahre 1323 hatte Ludwig der Baier aber nur die Stadt und ihre Bevölkerung an Thüringen verpfändet, das wichtige Schultheißenamt hatte er davon abgetrennt, um aus ihm noch gesondert Kapital zu schlagen. Dieses hatte er am 21. August 1323 für 500 Mark an die honsteinsche jüngere Linie verpfändet. In deren Besitz war es von 1323-1342, dann wurde das Pfand, da es vom Kaiser nicht eingelöst wurde, von den Thüringern durch Kauf erworben. Doch auch die Stadt selbst hatte noch einige Anfechtungen zu erleiden. Auch von Ludwigs Nachfolger, dem Kaiser Karl IV., wurde Nordhausen noch zweimal verpfändet, einmal an Thüringen, ein anderes Mal an Karls Gegenkönig, Günther von Schwarzburg, dem er 20.000 Mark Silber auszuzahlen versprach und dem er deshalb mehrere wichtige Reichsstädte abtrat. Dennoch brach unter ihm, etwa seit 1350, die Zeit an, wo sich die deutsche Stadt immer mehr durchsetzte und nicht bloß Städtebünde, sondern selbst einzelne Städte mit Erfolg ihren Landesherren oder dem Reiche die Stirne zu bieten wagten. Zusammenfassend ist also noch einmal festzustellen: Man muß dreierlei unterscheiden: die Stadt, die Vogtei und das Schulzenamt samt der Schutzherrlichkeit. Die Stadt war dauernd Freie Reichsstadt und nur 1323 bis 1333 an Thüringen verpfändet, die Vogtei war und blieb dauernd im Besitze der Honsteiner, das Schulzenamt war mehrfach verpfändet, zuletzt 1323 bis 1342 an die Honsteiner, von denen es dann Sachsen-Thüringen erwarb. Die Notlage des Reiches und die Abhängigkeit der Kaiser bedeuteten im 14. Jahrhundert jedenfalls wie für jede Reichsstadt, so auch für Nordhausen schwere Belastungen. Die Kaiser waren in den seltensten Fällen Beschützer ihrer Städte, meistens waren sie geradezu ihre Aussauger. Wenn man hinzunimmt die tausend Fehden jener Zeit, die Verwüstungen, die sie mit sich brachten, die Streitigkeiten mit einer zuweilen anmaßenden Kirche, Seuchen und Pestilenz, die schwere Menschenopfer forderten, schließlich noch die inneren Unruhen, welche die Straßen der Stadt nicht selten durchtobten, dann kann wahrlich von einer Gunst der Zeiten und Verhältnisse keine Rede sein. Wenn man dann aber trotz alledem in derselben Zeit eine erste große Blüte der deutschen Städte, darunter Nordhausens, feststellen kann, so wird einmal daraus ersichtlich, wie die Natur sich trotz aller Hemmnisse durchsetzt, wenn die Zeit erfüllet ist, so wird zum anderen damit aber auch erwiesen, wie stark und tüchtig das junge deutsche Bürgertum sich damals allen Gewalten zum Trotz entfaltete. Das Jahr 1290 hatte der Stadt die Bahn freigemacht für ihr Vorwärtskommen. Nach den ältesten, uns nicht erhaltenen Statuten ging Nordhausen im kurzen Zeitraum von 60 Jahren noch dreimal daran, sich Gesetze zu geben, weil die Entwicklung immer wieder neue Festsetzungen, nach denen die Bürger ihr Leben einrichten konnten, erforderte. Die ältesten Statuten wurden zwischen 1280 und 1290, die zweiten 1308, die letzten um 1350 aufgestellt. Alle späteren Gesetze sind großenteils nur Wiederholungen dieser älteren. Schon daraus wird der Glanz und das Machtbewußtsein der Bürgerschaft jener Zeit ersichtlich, daß sie sich damals einen rechtlichen Rahmen schuf, der Jahrhunderte lang paßte. Dann tritt diese Selbständigkeit aber auch zu Tage, wenn man die Rechte betrachtet, die den beiden Aufsichtsbeamten, dem Vogt und dem Schultheiß, verblieben waren.[4] 16Der Vogt hatte als oberster Reichsbeamter noch die Befugnis, dreimal im Jahre das voithdinc abzuhalten. Die Gerichtsbarkeit, hohe wie niedere, war ihm schon großenteils entzogen. Die Voruntersuchung leitete jedesmal das Schöffengericht unter Vorsitz des Schultheißen, und erst wenn die Untersuchung völlig abgeschlossen war, wurde der Verbrecher dem Vogte ausgeliefert. Dieser hatte nur das Urteil auf dem Markte in aller Öffentlichkeit zu sprechen und den Stab über den Übeltäter zu brechen. Da aber alle Angelegenheiten der Stadt, besonders die der Verwaltung, Finanzen und des Heerwesens gemäß den ihr seit 1290 zustehenden Rechten fortan vom Rate selbst in die Hand genommen wurden, erübrigte sich bald auch das dreimalige Vogtthing im Jahre. Der Brauch kam schon im 14. Jahrhundert in Vergessenheit; die Sitzungen des Vogts wurden reine Gerichtssitzungen. Das geht auch aus den Fassungen des Schulzenbuches hervor. Die erste Redaktion aus der Zeit um 1300 hat noch ... sed in tribus iudiciis, que voitdinc dicuntur, et tribus consimilibus iudiciis.[5] Die deutsche Revision dieses Gesetzbuches aus dem Jahre 1538, die im allgemeinen wörtlich übersetzt, sagt nur: der voith spricht kein urtheil nicht, ... sundem in drei gerichten und dergleichen. – Also nur die Urteilverkündung bei Strafprozessen blieb dem Vogt. Sein Amt wurde sehr schnell eine völlig einflußlose Sinekure. Man ließ ihm nach altem Brauche noch gewisse Abgaben zukommen, von irgendwelcher realen Macht und tatsächlichen Bedeutung war er nicht mehr. Seitdem aber der Vogt seine Stellung verloren hatte, konnte die Bürgerschaft umso tatkräftiger gegen den Schultheißen und seinen Pflichtenkreis anlaufen, um auch diesem Reichsbeamten das Heft aus der Hand zu winden und seine Befugnisse zu übernehmen. Das war allerdings viel schwieriger; denn dem Schultheißen kamen Obliegenheiten zu, die sich nicht nur nicht allmählich überlebten, sondern vielmehr mit der anwachsenden Stadt von immer größerer, insbesondere wirtschaftlicher Bedeutung wurden. Wir hatten gesehen, wie schon nach 1220 die Anforderungen an den königlichen Aufsichtsbeamten über Handel, Gewerbe und Marktgericht so gewachsen waren, daß er, ein Adliger und zunächst diesem Pflichtenkreise fernstehend, gar nicht mehr das ganze Feld seiner Betätigung überschauen konnte und daß er deshalb in weitgehendem Maße Bürger heranziehen mußte. Immerhin war sein Amt selbst nach den kaiserlichen Privilegien vom Jahre 1290 nicht ganz bedeutungslos. Als königlicher Beamter genoß der Schultheiß innerhalb seines Amtsbereiches eine Reihe von Vorrechten. Überall, wo er als Bevollmächtigter des Königs auftrat, war er von Verpflichtungen, die andere Bürger zu leisten hatten, befreit, wo er dagegen als Privatmann handelte oder als solcher innerhalb einer Genossenschaft stand, hatte er dieselben Leistungen aufzubringen wie jeder andere. So war er befreit von der Grundsteuer, denn Nordhausen stand auf dem Boden des Reichs, und der Reichsbeamte brauchte deshalb die auf diesem Boden ruhende Abgabe nicht zu zahlen. Dagegen mußte er natürlich von Gütern, die er während seiner Amtstätigkeit nicht als Schultheiß, sondern als Privatmann erwarb, Zins zahlen wie jeder andere. Ebenso war es die Stadt ihm schuldig, ihn von den gewöhnlichen Aufgaben und Pflichten eines Bürgers zu befreien. Er tat keinen Wachtdienst, er brauchte sich nicht zum Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen. Das Umgeld, das auf das Bierbrauen gelegt war, brauchte er für zwei Bier, d. h. für die Menge, die er und seine Familie für ihren Lebensunterhalt benötigten, nicht zu bezahlen; wollte er mehr brauen, so hatte er dafür Umgeld wie jeder andere zu entrichten. War er einerseits als Beamter von allen Lasten befreit, so hatte er andererseits als Angehöriger eines bestimmten Standes dieselben Lasten wie jeder andere zu tragen. Daher bestand die Anordnung, daß er, wenn er ein Handwerker war, allen seinen Verpflichtungen gegen die Zunft, der er angehörte, nachkommen mußte. Der ursprüngliche Pflichtenkreis des Schulzen tritt in einzelnen weiteren Gerechtsamen und Einnahmen hervor, die er auch in die spätere Zeit, wo er fast zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken war, hinüberrettete. Wir hatten schon gesehen, daß sein ältester und vornehmster Beruf die wirtschaftliche Beaufsichtigung des gesamten königlichen Grund und Bodens war. Daher rührte die Befugnis, die er bis in die Neuzeit hinein besaß, von allen Häusern und Erbgütern 28 Pfennig zu vereinnahmen. Jedes Haus in Nordhausen stand auf königlichem Boden, und deshalb zahlte der Besitzer eine Steuer nicht nur an die Stadt, sondern auch an den Vertreter des Reiches. Ebenso war es bei den Liegenschaften, die der Eigentümer direkt vom Reiche zu Lehen hatte, bei Gütern, die die Bauern als sogenannte Erbzinsgüter in erblichem Nießbrauch hatten; auch hiervon ging eine Steuer an den Schultheißen. Da aber keiner, der nicht Haus oder Grund und Boden in Nordhausen hatte, Bürger der Stadt werden konnte, so erteilte der Schultheiß im 13. Jahrhundert auch noch das Bürgerrecht. Als seit 1290 die Stadt hierfür zuständig wurde, zeigten doch die 28 Pfennig, die auch weiterhin für Erteilung des Bürgerrechtes an den Schultheißen zu zahlen waren, noch die alte Abhängigkeit. Der Rat der Stadt war zwar völlig selbständig in der Aufnahme von Bürgern geworden, aber wenigstens die Fiktion einer Oberaufsicht durch den Schultheißen war durch die Abgabe noch aufrechterhalten. Eng mit dem Handel der Stadt zusammen hing der Verkehr von und nach dem Marktorte, und deshalb stand dem Schulzen auch das Geleitrecht zu. Jeder, der durch städtisches Gebiet reiste, wurde an den Grenzen in Empfang genommen, ihm die Erlaubnis zur Durchreise und zum Hausieren gegeben, ihm während dieser Durchreise Schutz zugesichert, und dafür hatte er an den Schultheißen das Geleitgeld zu zahlen. Erst in der Mitte des 16. Jahrhunderts übertrug Karl V. den Nordhäusern das Geleitrecht. Endlich kann man auch darin noch die Befugnisse des Schulzen über Grund und Boden erkennen, daß er bis in die ersten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts hinein die Berechtigung hatte, Hypothekenbriefe auszustellen. Erst damals machte ihm die Stadt auch dieses Recht streitig. Doch sein für die Stadt wichtigstes Amt bestand in der Ausübung der Marktgerichtsbarkeit. In erster Linie war der Schultheiß der Vorsitzende des Schöffengerichts, das die Zivilgerichtsbarkeit innehatte. Sein Titel war praefectus, die beiden Beisitzer hießen iudices, Schöffen, Gerichtsfronen oder discreciores civitatis. Zu diesen Schöffen wurden schon im 13. Jahrhundert einheimische Bürger herangezogen, die der Schultheiß als Sachverständige besonders nötig hatte. Vor das Schulzengericht gehörten in ältester Zeit nur handels- und gewerberechtliche Angelegenheiten, ferner besaß es die Zuständigkeit über das Pfand-, Schuld- und Erbrecht. Die gesamte übrige Gerichtsbarkeit, besonders die Strafgerichtsbarkeit, besaß der Vogt. Da aber der Schulze auch die Marktpolizei ausübte, so zog er bald auch strafrechtliche Fälle vor sein Gericht. So besaß er schon am Ausgang des 13. Jahrhunderts die Gerichtsbarkeit über Friedensbrüche, über Räubereien während des Marktes und über Eigentumsvergehen jeder Art. Die Stadt aber hatte ein Interesse daran, die Kompetenzen des Schulzengerichts möglichst weit zu ziehen, da sie ja durch die Schöffen in diesem Gerichte ausschlaggebend war, während ihr dem Vogte gegenüber keine Handhabe gegeben war, ihren Einfluß zur Geltung zu bringen. Ja im alten Schultheißenbuche des 14. Jahrhunderts finden wir schon die Bestimmung: si scultetus egerit in aliquem pro furto vel pro spolio vel pro qualicumque causa, et si secundum ius evaserit, solutus erit ab advocato pro tali causa. Hier tritt ganz deutlich zutage, daß dem Schultheißen neben der Zivilgerichtsbarkeit nur über Diebstahl und Raub abzuurteilen obgelegen hatte; dann aber fügt man hinzu: vel pro qualicumque causa „oder über irgend eine andere Sache“. Nach diesem Schulzenbuche führte also der Schultheiß auch die Voruntersuchung in jeder Strafsache, und erst, wenn die Schuld des Angeklagten feststand, verwies man den Prozeß an das Blutgericht des Vogts. Flüchtete der Verbrecher, so ließ der Schultheiß ihn verfolgen durch seine Büttel, leitete die Voruntersuchung und stellte dem Geschädigten das entwendete Gut wieder zu. So erweiterte das Schulzengericht gegenüber der Vogtei seine Befugnisse mit Hilfe der Städter, und dann, nachdem der Vogt zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken war, gingen diese gegen das Amt des Schultheißen vor. Die ursprünglichen Kompetenzen und insbesondere die gesamte Oberaufsicht über das Schulzenamt durch den Vogt läßt sich nur noch daran erkennen, daß ihm ein Drittel aller Gerichtsfälle vom Schulzengericht abgegeben werden mußte. Der Schultheiß hegte die Gerichtsbank mit der Frage, ob jetzt Richtens Zeit sei. Wenn sie bejaht wurde, „stand“ das Gericht. Dann trat man in die Verhandlungen ein; ein Gerichtsschreiber und ein Büttel standen dem Schulzen zur Seite. Wie beim gesamten Gerichtsverfahren des Mittelalters, so spielte auch im Zivilgericht der Reinigungseid der Hauptrolle. Er wurde bei gehegter Bank vor dem Schultheißen abgelegt; nur Juden legten ihn vor der Judenschule ab; doch entsandte der Schultheiß einen Boten dazu. Schwere Strafe, nämlich eine Buße über 3 Pfund Silbers, traf den, der den Eid leichtfertig und ohne Erlaubnis des Schulzen ablegte. Den Urteilsspruch fand das Gericht bei geringeren Sachen allein. Selbstverständlich fiel die Stimme des Schultheißen als Vorsitzenden des Gerichts zunächst gewichtig in die Wagschale; erst seit der Mitte des 14. Jahrhunderts bestritten die Nordhäuser dem Schulzen das Recht, den Urteilsspruch mitzufinden, und beanspruchten dieses Recht allein für die beiden Schöffen, auf die sie ja, da sie aus ihrer Mitte genommen waren, von viel größerem Einfluß waren als auf den Schultheißen. Diesem sollte, abgesehen vom Hegen des Gerichts und der Eidabnahme, nur noch die Verkündung des Spruches zustehen. Wenn wichtigere oder schwer zu beurteilende Angelegenheiten zur Verhandlung standen, so daß das Schöffengericht nicht allein den Spruch abzugeben wagte, so „borgte“ man sich das Urteil, holte ein „Weistum“ ein. Im allgemeinen wandte man sich dabei an Goslar, dann, wenn das Goslarer Urteil nicht befriedigte, an Mühlhausen. Bei außergewöhnlich wichtigen Prozessen holte man sich das Urteil auch von ganz berühmten Schöffenstühlen, vor allem von Magdeburg, und ließ es sich dann auch gehörig Geld kosten, wie denn hinter einem Magdeburger Weistum anzumerken nicht vergessen wird: „unde hat gekost 23 Rinsche gülden“. Schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde es übrigens üblich, die Prozeßakten an den Rat der Stadt einzuschicken und diesen nach seiner Meinung zu fragen, so daß allmählich der Syndikus der Stadt Nordhausen den Ausschlag bei der Urteilsfällung gab. Dieser Brauch, der gewohnheitsmäßig schon früh geübt wurde, erhielt Rechtskraft durch ein königliches Privileg vom 10. August 1349, wo Karl IV. zu Köln der Stadt Nordhausen gewährte, daß die Urteile des Rates „Kraft und Macht“ haben sollten. Und in einer zweiten Urkunde, die am 10. September 1354 in Zürich gegeben worden war, erweiterte der städtefreundliche Kaiser noch die Aufsichtsbefugnis der Stadt über das Schulzengericht. Diese beiden Urkunden neben der Rudolfs vom Jahre 1290 waren die Grundlagen, von denen aus die Hoheit der Stadt weiter ausgebaut werden konnte. Im übrigen waren die Befugnisse und Einkünfte des Schultheißen durch sein Aufsichtsamt über den Verkehr und den Handel der Stadt bestimmt. Eine seiner wichtigsten Obliegenheiten in dieser Beziehung war die Überwachung der Münze zu Nordhausen. Im 12. und im Anfang des 13. Jahrhunderts standen die Münzmeister, monetarii oder magistri monetae, die ebenso wie Vogt und Schultheiß Ministeriale der Burg waren, noch fast selbständig neben diesen Beamten und traten auch selbständig in Urkunden auf.[6] Seitdem aber die Tätigkeit des Schulzen auf die Stadt beschränkt war, wurde ihm die Münze mitunterstellt, und der monetarius erschien nunmehr nur noch als Unterbeamter des Schultheißen. Dieser verpachtete meistens die Münzen an Unternehmer, behielt aber jederzeit die Oberaufsicht. Er bestimmte nach höheren Anweisungen Gewicht und Feingehalt der Geldstücke, er schloß auch mit anderen Städten über die Anerkennung der Nordhäuser Münze und ihren Wert Verträge ab. So sind z. B. aus älterer Zeit vom 30. März 1322 und 14. Juli 1360 Verträge über die Münze mit Ellrich auf uns gekommen. In den dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts galten 30 Schilling gleich einer Mark Silber, in den sechziger Jahren 50 Schilling, 1382 gar 52 Schilling gleich einer Mark.[7] Diese Verträge wurden nötig nach der Zeit, wo die Honsteiner um 1340 und 1350 das Schulzenamt besessen und damit einen wahren Raubbau betrieben hatten. Sie zeigen, wie wichtig selbst in jenen Zeiten, deren Handel doch noch großenteils auf der Naturalwirtschaft fußte, eine vollwertige Münze war, und daß die Verschlechterung der Münze zu der Zeit, wo die Honsteiner Besitzer des Schulzenamts waren, dem Handel und Verkehr sofort größten Schaden zufügte. Aus der Münze flössen dem Schultheißen auch die stattlichsten Einnahmen zu, die sich schon im 14. Jahrhundert auf 30 bis 70 Mark jährlich beliefen. Stets war in Nordhausen die Ausprägung von Münzen üblich wie die in Sachsen und Thüringen. Der Nordhäuser Verkehr und Warenaustausch zeigte im Mittelalter nach Süden. So gab z. B. am 9. Oktober 1448 Wilhelm von Sachsen als Inhaber des Schulzenamtes in Nordhausen der Stadt das Recht, für 400 Gulden Münzen auszuprägen, wie die zu Eisenach, Weißensee und Saalfeld, und 1538 lautet eine Bestimmung: „Item man zu Northausen münzet, so hat unser gnediger Herr von Doringen die schlegeschatze daran.“ Dieser wünschte auch nach der neuen vom Kaiser Maximilian geschaffenen Kreiseinteilung das Ausmünzen gemäß der Obersächsischen Kreisordnung, obgleich Nordhausen dem Niedersächsischen Kreise zugeteilt war und in der Tat schon seit dem 15.Jahrhundert wirtschaftlich mit Quedlinburg, Halberstadt, Braunschweig und Lüneburg ebenso im Verkehr stand wie mit den thüringischen Städten. Zur Aufrechterhaltung der Münzstätte und für ihre Überwachung flössen dem Schultheißen die Einkünfte von dem sogenannten „großen“ Zolle und die Abgaben einer Reihe von nach Nordhausen hin steuerpflichtigen Dörfern zu. Unter dem „großen“ Zoll verstand man die Steuer, welche auf dem nach Nordhausen eingeführten Wein ruhte und die zwischen 4 Pfennig für einen Wagen mit Wein und 1 Pfennig für eine Weinkarre schwankte. Wein, der nicht zum Selbstverbrauch oder sofortigen Ausschank verwertet wurde, sondern den man zu späterem Verkauf erst lagern ließ, wurde doppelt so hoch besteuert. Von den Dörfern zahlten im 14. Jahrhundert Bielen, Windehausen, Urbach, Görsbach, Grumbach bei Bielen, Vorrieth bei Kleinfurra, Eire, Horn und Wiechstädt besonders Hafer zur Nordhäuser Münze,[8] im 16. Jahrhundert leistete auch noch Steinbrücken eine Abgabe, von Crimderode kamen 4 Schock Reisholz, das Kloster von Ilfeld steuerte jährlich ein Fuder Holz, das Walkenrieder 10 Ellen graues Tuch bei. Ilfeld und Walkenried waren zu der Abgabe wegen ihrer in Nordhausen befindlichen Klosterhöfe verpflichtet, aus denen sie ja mancherlei merkatorischen Vorteil zogen. Neben der Münze gehörte zu den Aufgaben des Schultheißen die Erhebung und Überwachung des Zolls. Von allen Waren, die in die Stadt eingeführt und dort verkauft wurden, wurde ein Zoll erhoben; nur die Waren, besonders Getreide ünd Lebensmittel, welche ein Bürger draußen aufgekauft hatte, um seinen eigenen Bedarf zu decken, waren zollfrei. Der Zoll ward erst entrichtet, wenn die Ware in der Stadt abgesetzt war.[9] Als Strafe für unverzollte, ohne Steuermarke ans Stadttor gelangende Waren sieht das Schulzenbuch von 1538 eine Geldbuße an den Schultheißen von 1 Pfund Geld 20 Schneebergern vor. Wenn die Ware zu geringfügig war, mußte der Versuch der Hinterziehung wenigstens mit 1 Gulden gebüßt werden. Eingeführt in die Stadt aber wurden besonders die Produkte der ländlichen Umgebung: Getreide, Mohn, Hanf, Hopfen, Holz, Weidenruten. Von weiterher kamen Fische, insbesondere Heringe, ferner Wein, Met, Bier, aber auch Farbstoffe wie z. B. Waid. Doch auch Fertigfabrikate der Umgebung sowohl, wie der weitesten Feme gelangten nach Nordhausen, insbesondere Webwaren aus Wolle und Leinwand. Waren unter dem Werte von 1 Schilling ließ man zollfrei durch. Ebenso waren für die beiden Jahrmärkte im Frühjahr und Herbst Erleichterungen gewährt. Dann wurde für alles, was in einer Bude verkauft wurde, nur 2 Pfennige Zoll entrichtet; wenn der Verkäufer auf dem Jahrmarkt aber keine Bude besaß, zahlte er den gewöhnlichen Zoll, da ja jede Übersicht über das zum Verkauf Gebrachte fehlte und ein solcher Handel dem Jahrmarkt nicht zugerechnet wurde. Im späteren Mittelalter besuchten die Jahrmärkte auch gern einheimische und fremde Fleischer und Bäcker, die dann ähnlich wie alle übrigen Budenbesitzer besteuert wurden. Ganz besonders tritt aber die Abhängigkeit der Stadt vom Schultheißen als Marktherm und Inhaber des Kaufmanns- und Gewerbegerichts hervor durch die Abgaben, welche die Innungen jährlich dem Schultheißen zu leisten hatten. Abgesehen davon, daß jeder Inhaber für seinen Stand auf den zunächst zwei, später drei Wochenmärkten ein kleines Standgeld zu entrichten hatte, mußten auch die einzelnen Interessengemeinschaften, die Zünfte, zum Zeichen der Anerkennung der schultheißlichen Gewerbehoheit alljährlich eine Abgabe entrichten. Sie unterlag naturgemäß in den vier Jahrhunderten von 1300-1700 Schwankungen, ist aber stets festgehalten worden. So entrichteten 1538 die Kaufleute 10 Schillinge (zu 9 Pfennig), die Schneider 3, die Fleischer 20, die Gerber 10, die Bäcker 6, die Wollweber 4, die Leinweber 6, die Schuhmacher 30, die Schmiede 4, die Krämer 4 Schillinge. Das Schulzenbuch aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts zählt neben diesen noch die Filtores, die Filzer, und die Picariatores, die Becherer, auf, enthält dagegen noch nicht die Schneider.[10] Sämtliche Einnahmen aus dem Zivilgericht, der Marktherrlichkeit, den Zöllen und der Münze mit geringen Ausnahmen hatte der Schultheiß an seine Oberherm, seit 1352 also dauernd an Thüringen und Sachsen, abzuführen. Nur den Zoll für einige geringwertige Waren wie für Käse, Nüsse und Kastanien konnte er für sich einbehalten; ferner fiel ihm die Hälfte der Gerichtsstrafen zu, doch mußte er dafür die beiden Schöffen während der Gerichtssitzungen unterhalten. Im übrigen bezog er im 16. und 17. Jahrhundert ein jährliches Einkommen von 20 Talern und war von den städtischen Steuern befreit. Aus allen diesen Darlegungen wird ersichtlich, daß das Schultheißenamt für die Stadt hochbedeutsam war, jedenfalls von viel größerer Wichtigkeit und viel weittragenderem Einfluß als die Vogtei. Das, worauf die ganze Daseinsberechtigung einer Stadt innerhalb eines Gesamtorganismus beruht, das, worauf die Bewohner einer Stadt ihr ganzes Sein begründen, das gesamte Wirtschaftsleben stand in irgendeiner Beziehung und meist auch in irgendeiner Abhängigkeit zum und vom Schulzenamt. Dementsprechend behandelten auch die Bürger das Amt: Es streckte seine Befugnisse in alle städtischen Verhältnisse, und deshalb mußte jeder Bürger zu ihm irgend eine Stellung nehmen; es erschien, je länger, je mehr, als die wirtschaftliche und staatliche Selbständigkeit einengend, und deshalb mußte jeder freie Bürger es als unbequeme Last empfinden. Obenhin ist daher schon immer angedeutet worden, daß die Stadt Nordhausen bestrebt war, sich nach und nach die Rechte des Amtes anzueignen; wirklich erworben, wie es die Nachbarstadt Mühlhausen tat, hat Nordhausen das Schulzenamt erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts und ist erst damit eigentlich wirklich „Freie“ Reichsstadt geworden; aber an widerrechtlichen Eingriffen in das Schulzenamt, an Abtrennen einzelner Befugnisse von ihm, an durch keine Urkunden zu belegenden Behauptungen über das Machtbereich der Stadt, schließlich sogar an völligen Kassierungen des Amtes durch die Stadt hat es zu keiner Zeit gefehlt, von dem Augenblicke an, wo Nordhausen 1220 wirklich Reichsstadt geworden war, bis zu dem Augenblick, wo es 1715 seine volle Souveränität von Preußen erkaufte. Diese Schmälerung der Rechte des Reiches durch Nordhausen war ja auch leicht möglich; überall bot sich ja eigentlich das Schulzenamt den Eingriffen und Zugriffen der Stadt dar. Das lag ganz einfach an den eigenartigen mittelalterlichen Verfassungs- und Verwaltungsverhältnissen. Innerhalb eines nach möglichster Selbständigkeit strebenden Gemeinwesens war der Schultheiß der einzige Vertreter der gesamtstaatlichen Hoheitsrechte, keiner leistete ihm dabei Hilfe, ja das Reich selbst oder der Staat, an den das Reich seine Hoheitsrechte abgetreten hatte, besaß kaum mehr Interesse an deren Wahrung, als daß ihm der Anspruch auf das Amt gewisse Einnahmen davon sicherte. Man ist fast versucht zu erklären, daß das Mittelalter einen recht konservativen Zug an sich trug, daß es auf Tradition und verbriefte Rechte außerordentlich viel gab, wenn man sieht, wie ein Amt von solcher Bedeutung wie das Schulzenamt für Nordhausen, eigentlich durch keine reale Macht, sondern nur durch das Herkommen und durch alte, meist sogar halb in Vergessenheit geratene oder abhanden gekommene Urkunden gesichert, sich überhaupt solange hat behaupten können. Hinter dem Schultheißen stand bei Ausübung seines Amtes niemand, er war ganz und gar auf die Hilfe der Bürger angewiesen. Seine wichtigsten Berater, die Schöffen, mußte er aus der Bürgerschaft nehmen; ebenso waren die ausführenden Beamten, die Zollbeamten, die Büttel, die Gerichtsdiener Einwohner der Stadt. Alles, was mit dem Amte zusammenhing und darin irgendeine Tätigkeit ausübte, war städtisch. Dennoch kann man sagen, daß, obgleich während des ganzen 14. Jahrhunderts die städtische Macht ausgebaut wurde, das Amt doch bis ins 15. Jahrhundert hinein, abgesehen von kleinen Einbußen, Bestand gehabt hat. Erst seit etwa 1450 ist ein wirkliches Abbröckeln einer Befugnis nach der anderen ganz offensichtlich. Abgesehen von diesen Einschränkungen durch die Amtsgewalt des Schultheißen regierten sich die Bürger selbständig. Doch nahmen zunächst nur die Gefreundten, die Geschlechter an der Verwaltung der Stadt teil; erst im Laufe des 14. Jahrhunderts macht sich ein allmählich immer stärker werdender Druck der Bevölkerung, die Mitbestimmung verlangte, bemerkbar. Welche Aufgaben aber im Mittelalter dem Rate zufielen, ist ein für das deutsche Städtewesen so wichtiges Kapitel, daß wir auch hier auf sie eingehen wollen, besonders da sie bisher für Nordhausen noch nicht näher umschrieben worden sind. Schon lange vor dem Jahre 1290 hatte sich der Rat der Stadt Nordhausen in einem Rathause für seine Sitzungen und Beratungen eine geeignete Stätte geschaffen. Wir pflichten Karl Meyer bei, daß dieses älteste Versammlungshaus zwischen den beiden Gäßchen, die heute das Westende der Krämerstraße nach dem Steinweg hin bilden, gestanden hat. Hier lagen die Gewandkammem der Gewandschnitter, der ältesten und vornehmsten Gilde Nordhausens, deren Mitglieder als Patrizier im Rate saßen und die ihr Kauf- und Gildehaus zugleich als Rathaus benutzten. Doch schon um 1280, wahrscheinlich bald nach dem Sturze der Reichsritterschäft und der Zerstörung der Reichsburg, gingen die reichen Kaufleute daran, in unmittelbarer Nähe der Marktkirche, auf dem Platze, auf dem es noch heute steht, ein neues Rathaus zu bauen. Auch jetzt war in ihm die Mehrzahl der Räumlichkeiten den Kaufleuten für das Feilhalten ihrer Waren vorbehalten. Es besaß 12 obere, 16 mittlere und 16 untere Kaufkammem. Doch seine wesentliche Bedeutung bestand darin, daß es der Mittelpunkt für die städtische Verwaltung war. Dieses neue Rathaus genügte nur 80 Jahre den Ansprüchen der Bürgerschaft; im Jahre 1360 wurde es umgebaut. Nachdem dieses neue Rathaus gebaut und dorthinein die Gewandkammem gelegt worden waren, nannte man das älteste Rathaus antiquum mercatorium, das „alte“ Kaufhaus. Das Rathaus in seiner neuen Gestalt vom Jahre 1360 war nun die Stätte, von wo aus die Ratsregimenter die Stadt Nordhausen lenkten und verwalteten.[11] Es ist verständlich, daß in den Anfangszeiten des Rates, wo sich noch keine ganz fest umrissene Geschäftsordnung herausgebildet und wo die Behörde den Bürgern gegenüber noch keine feste Stellung und Tradition hatte, die Verwaltungstätigkeit auf manche Schwierigkeiten stieß. Hinzu kam noch, daß der Charakter der Zeit einem reibungslosen, friedfertigen Verkehr der menschlichen Gesellschaft durchaus widerstrebte. Bei hoch und niedrig war das Wort grob und schnell die Tat. Die stolzen Patriziergeschlechter kannten weder untereinander Rücksicht noch dem geringen Manne gegenüber, und dieser selbst war weit entfernt, sich in die ihm auf erlegte Ordnung ohne weiteres zu fügen. Erst im 15. Jahrhundert zog größere Ruhe ein, kam größere Stetigkeit in den Geschäftsgang, festigten sich die Verhältnisse im Innern der Stadt. Aus dieser Sachlage heraus sind die Verordnungen zu verstehen, die die Rechte der Ratsherrn zu umschreiben trachteten, den Verkehr untereinander regelten und ihre Stellung innerhalb der Gesamtbürgerschaft festlegten. Je älter die Statuten sind, desto mehr Anordnungen finden sich ausgesprochen und zwischen den Zeilen, welche gerade Übergriffe zu verhindern suchten; unter der Gesamtzahl der Gesetze befinden sich gerade in den älteren Zeiten viel, die sich mit der Sicherung des Rates beschäftigen. Die vornehmen Geschlechter hatten die Reichsritter entthront. Die gemeinsame Sache hatte sie zusammengeschweißt, und fest hielten sie zusammen gegen oben und unten, darauf bedacht, ihre Rechte zu wahren. Doch so sehr sie aufeinander angewiesen waren, so ließ es ihre Streitbarkeit und ihr Stolz doch nicht zu, daß sie sich auch nur einem ihresgleichen unterordneten oder im Rate und mit der Tat vor einem der ihrigen zurückwichen. So trug ihre Herrschaft durchaus das Antlitz jeder oligarchischen Herrschaft: nach oben hin war sie anarchisch, untereinander waren sie monarchisch, nach unten hin war sie despotisch. Die Rechte der Aufsichtsbehörde suchten diese Ratmannen immer weiter einzuschränken, und in den Zeiten nachsichtiger und schwacher Schutzherrn galten ja schon im 14. Jahrhundert tatsächlich Vogt und Schultheiß überhaupt nichts mehr. In den Nordhäuser Statuten werden die Reichsbeamten gar nicht erwähnt; man tut so, als seien sie für die Stadt nicht vorhanden. Bei den Sitzungen der Geschlechter untereinander, bei den Ratsversammlungen ging es nicht selten lebhaft genug zu. Beschimpfungen, ja Tätlichkeiten kamen vor, so daß die Statuten Bestimmungen treffen mußten, die dergleichen Ausschreitungen ahndeten. Auch der Hinweis darauf, daß die Beratungen streng vertraulich sein sollen, kommt immer wieder vor und beweist, daß die Herren vom Rate zuweilen die Lust verspürten, ihrem übervollen Herzen vor aller Welt Luft zu machen und dadurch den Interessen der bevorrechteten Kaste zu schaden. Besonders aber war es nötig, die Stellung der Patrizier nach unten zu sichern. Deshalb legen die Statuten dem eine doppelte Buße auf, der einen Ratsherren tötet, lähmt, verwundet, über ihn das Schwert zückt, ihn mißhandelt oder mit Worten beleidigt. Ebenso ist der gesamte Rat vor Angriffen geschützt. Üble Nachrede und böswillige Kritik an den Maßnahmen des Rates wird bestraft, Schmähungen bei der Ratswahl gegen in den Rat Gewählte werden mit 5 Mark Silbers und 5 Jahren Verbannung geahndet. Widersetzlichkeiten gegen Befehle des Rates werden ähnlich bestraft. Interessant ist es, daß die ältesten Statuten vor 1300 zwar Bestimmungen aufweisen über den Verkehr der Bürger mit den Behörden innerhalb und außerhalb des Rathauses, daß aber erst die späteren Statuten aus dem 14. Jahrhundert, also aus der Zeit der eigentlichen Ständekämpfe, Ahndungen vorsehen wegen Störungen der Ratssitzungen durch einen Auflauf oder gar durch Eindringen der Bürger in die Versammlung. Niemand darf sich mit Gewalt Gehör zu schaffen suchen. Der Bürger darf auf das Rathaus kommen, muß aber unbewaffnet sein, er darf zwar Einspruch dort erheben, aber mit der nötigen Wohlanständigkeit und Ehrerbietung. Ein wirklicher Einfluß wird den niederen Bürgern zunächst überhaupt nicht, später nur durch die Mittelsmänner aus den Zünften und den Vierteln der Stadt zugestanden.[12] Die Befugnisse dieser bevorrechteten, durch zwiefältige Buße geschützten Ratsherren sind sämtlich aus dem Aufsichtsrecht über den Markt und seinen Verkehr abzuleiten. Der Markt bildet die Grundlage für die gesamte Verfassung und Verwaltung der Stadt, er ist die Keimzelle, von wo aus sich die Rechte des Rates und der Bürgerschaft in demselben Maße vergrößerten, wie die Stadt selbst und ihr Handel und Wandel. Schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts hatten sich die Reichsbeamten nur das vorbehalten, was leicht übersehbar und verwaltbar war, was dennoch erfreuliche Einnahmen gewährte und was zugleich von der übrigen Verwaltung der Stadt, für die man doch keine Organe hatte und die man deshalb den Bürgern überlassen mußte, leicht abtrennbar war. Das waren der Zoll und die Münze. Diese blieben deshalb auch längste Zeit Reichsgut, wenn auch die Münze mit gewissen Einschränkungen. Das Dritte, was sich der Schutzherr der Stadt für seinen Vertreter, den Schultheißen, vorbehielt, war die Zivil- und niedere Strafgerichtsbarkeit. Doch war hier die Abgrenzung zwischen städtischer und oberherrlicher Kompetenz nicht so leicht vorzunehmen, und so bot denn das Schultheißengericht auch oft genug Anlaß zu Konflikten aller Art. Auf der einen Seite standen die Rechte des Schultheißen, dem eigentlich die gesamte Gewerbe- und Handelsgerichtsbarkeit zustand, auf der anderen Seite standen die weniger rechtmäßig begründeten als allmählich historisch erworbenen Rechte des Rates, der die gewohnheitsmäßige Handhabung der Verwaltung und die Aufsicht über den gesamten Produktions- und Konsumtionsprozeß innehatte. Dieser Handel und Wandel spielte sich auf dem Markte ab und benötigte in erster Linie des Friedens. Deshalb war es auch die vornehmste Aufgabe des Rates, den Marktfrieden zu gewährleisten. Die Hälfte aller Bestimmungen der ältesten Statuten handelt daher von der Wahrung des Marktfriedens. Der König hatte einst der Ansiedlung den Markt geschenkt, und der Königsfrieden lag über der Stadt, aber ihn beschützen mußte der Rat. Jeder, der den Marktfrieden brach, handelt deshalb „wider des rates geböte“ und wurde vom Rate gebüßt. Ja, auch des einzelnen Ratmannen wichtigste Aufgabe war die Bewahrung des Friedens. Wo es zu Streitigkeiten kam, hatte der Ratmann, der gerade anwesend war, Frieden zu gebieten. Jeder hatte ihm zu gehorchen und gegebenenfalls Hilfe zu leisten, denn: he is in der stat botschaft. Der Ratmann, der diese seine vornehmste Pflicht vernachlässigte, verfiel selbst der Strafe. Über den so gefriedeten Markt und seinen Verkehr führte der Rat die Aufsicht. Sollte der Handel hier aber wirklich für die Bevölkerung ersprießlich sein, so war es besonders wichtig, daß mit bestimmten, von der Obrigkeit anerkannten Münzen gezahlt und einheitliches Maß und Gewicht bei Kauf und Verkauf benutzt wurde. Wenn nun freilich auch die Münze dadurch, daß sie unter die Kompetenzen des Schultheißen fiel, der Beaufsichtigung durch den Rat entzogen war, trifft das doch nur für die Ausprägung zu und für die Einnahme, die aus dem Regal flössen. Sowie die Münze in den Handel trat, griff der Rat ein; denn in diesem Augenblicke hatte ja der Schultheiß keine Organe mehr, seine Münze, etwa vor Nachahmung und Fälschung, zu schützen, und gerade das ist das Wesentliche für das Gedeihen der Stadt. Denn durch schlechte und falsche Münze wird der Marktbetrieb gestört und geschädigt. Deshalb sind in den Statuten auch Bestimmungen über die Nordhäuser Münze aufgenommen. Schon 1308 wird festgelegt, daß derjenige niemals Bürger werden soll, der mit Nordhäuser Münze die Stadt verläßt, sich anderwärts niederläßt und dort das Nordhäuser Geld nachzuahmen sucht. Auch der, welcher solche Münzen einwechselt oder wechseln läßt, wird mit Strafe bedroht. Der Einheitlichkeit wegen war ferner dem Rate daran gelegen, daß die Bürger Nordhausens möglichst nur Nordhäuser Geld in Zahlung nahmen und gaben. Zugleich erreichte er dadurch, daß die Nordhäuser Münze galt, soweit sich das Einzugsgebiet des Nordhäuser Marktes erstreckte. Von den Höhen des Harzes bis südlich der Hainleite, von Heiligenstadt bis über Kelbra hinaus war daher Nordhäuser Geld das gangbarste. Allerdings konnte man gleichwertige Münzen auch gegen Nordhäuser umtauschen. Daß auch diese Bestimmungen über den Geldwechsel vom Rate ausgingen, ist selbstverständlich, da die Kaufleute die besten Fachleute für Gültigkeit und Wert fremder Geldsorten waren. – So erscheint gerade beim Münzwesen sehr schön die Abgrenzung der schutzherrlichen und städtischen Befugnisse: Alles, was mit der Ausprägung der Münze zusammenhängt, ist königliches Regal, alles, was mit dem Verkehr der Münze in der Öffentlichkeit zusammenhängt, unterliegt der Aufsicht der Stadt. Neben der Regelung und Vereinheitlichung der Zahlungsmittel erstreckte sich weiterhin die Sorge des Rates auf Maß und Gewicht. Diese nahmen insofern eine andere Stellung ein als die Münze, als sie nie in den königlichen Urkunden erscheinen, sondern die Aufsicht über sie von vornherein der Stadt zusteht, unbedingt eine Folge davon, daß der mittelalterliche Staat, wie Below schon ausgeführt hat, selbst den kleinsten Gemeinden die Sorge für rechtes Maß und Gewicht überläßt. Dieses Verhalten des Staates ist auch verständlich, weil die Münze als Tauschmittel für die Gesamtheit dient, Maß und Gewicht aber nur beim Handel und Verkehr von Einzelpersonen von allerdings einschneidendster Bedeutung sind. Hier haben wir es mit rein kaufmännischen Instrumenten zu tun, alles Kaufmännische aber hält sich der mittelalterliche Staat vom Leibe, weil es ihm dabei doch nicht gelingt, beaufsichtigend und regelnd einzugreifen. Maß und Gewicht unterstehen also durchaus der Verwaltung des Rates. Ihre Überwachung ist aber eine umso wichtigere Angelegenheit, als bei der Vielheit der gebräuchlichen Maße und Gewichte und der Ungenauigkeit bei der Herstellung dem Betrüge Tür und Tor geöffnet war. Deshalb wurden auch Vergehen gegen Maß und Gewicht verhältnismäßig nur leicht geahndet; denn häufig war gar nicht nachweisbar, ob bloße Fahrlässigkeit oder wirkliche Fälschung vorlag. Trotzdem war natürlich dem Wirtschaftsleben sehr viel an genauem Maß und Gewicht gelegen, und der Rat suchte mit Verfügungen den Handel vor Ausbeutung zu schützen. „Wer unrechtes Gewicht, Scheffel, Ellenmaß, Molmetze hat, gibt dem Rate 1 Mark.“[13] Das wichtigste Instrument zur Bestimmung genauen Gewichts war die Ratswage, die in ältester Zeit wahrscheinlich im Rathause untergebracht war, im ausgehenden Mittelalter aber mitten auf dem Kornmarkte stand. Auf ihr mußten alle größeren Warenmengen gewogen werden; nur dem Detailhandel waren eigene Wagen gestattet. So konnten die Wollweber bis zu 3 Steinen Gewicht (1 Stein = 20 Pfund), die Krämer bis zu 7 Pfund, die Kupferschmiede bis zu 10 Pfund ohne Nachprüfung verkaufen. Jeder größere Posten mußte aber auf der Ratswage abgewogen werden. Dafür wurde ein geringes Wiegegeld, meistens ein Scherf, die kleinste Münze, von dem Ratswagenmeister erhoben. Für Tuche hatte die Stadt eine eigene Wage, die Schröterwage, auf der neues Gewand von 2 Ellen aufwärts gewogen werden mußte. Die Hauptsache bei der Bestimmung des genauen Gewichts waren die Gewichtsstücke. Um völlig einwandfreies Gewicht zu haben, besaß die Stadt die Gewichtsstücke in dreifacher Ausfertigung. Die einen der Gewichte hatten die 4 Kämmerer der Stadt in Verwahrung, die anderen lagen in der Bomkammer, einem Anbau an das Rathaus. Diese dienten gewöhnlich dem Gebrauche. Die dritten wurden im „Gewölbe der Privilegien“ aufbewahrt, d. h. im Archiv auf dem Rathause; diese galten als die maßgebenden. Sie wurden nur gebraucht, um die Richtigkeit der anderen nachzuprüfen. Schon in dieser Tätigkeit des Rates erscheint eine der Hauptobliegenheiten der städtischen Organe: dem Produzenten das Seine zukommen zu lassen und den Konsumenten vor Ausbeutung zu schützen. Dieses Bestreben zeigen auch weiterhin alle Bestimmungen des Handels, die der Rat als Inhaber des Marktes vornahm. Teilweise sind sie sehr einschneidend und mußten von den Handelsleuten häufig als recht lästig empfunden werden, wurden aber mit Rücksicht darauf, daß durch sie für jeden ein geringes, aber sicheres Auskommen gewährleistet wurde, in Kauf genommen; ja, wenn der Staat nicht eingriff, legten die Kaufleute und Handwerker selbst ihrem Handel und Gewerbe Fesseln an, um keinen zu reich, keinen ganz arm werden zu lassen. Diese Mittelstandspolitik, welche die Bewegungsfreiheit, die Rührigkeit und den Wagemut des Einzelnen stark beschränkte, entsprang aus einem starken demokratischen Gefühl des Mittelalters für die Gleichheit aller Angehörigen eines Standes. Sie alle nannten sich Bürger, und diese sollten alle unter annähernd gleichen Lebensbedingungen leben. Zur Überwachung des Handels hatte der Rat 2 Ratmannen bestimmt. So verbot der Rat der Stadt Nordhausen den Vorkauf. Erst wenn zu einer ganz bestimmten Zeit das Marktfähnlein herausgesteckt erschien, war damit der Markt eröffnet, und der Handel begann. Dabei mußten zunächst die Bedürfnisse der einheimischen Bürger befriedigt werden, und erst dann, wenn dies geschehen, wurden auch Fremde zum Markte zugelassen. Ganz besonders aber betrieb der Rat Mittelstandspolitik durch seine Verfügungen über das Kredit- und Genossenschaftswesen. Anfang des 14. Jahrhunderts war es Einzelpersonen oder einer Gesellschaft überhaupt verboten, einen Kauf oder Verkauf über 24 Mark lötigen Silbers zu tätigen. Einige Jahrzehnte später durften zwar Waren, deren Wert 20 Mark überstiegen, eingekauft und auch weiterverhandelt werden, doch man glaubte, daß in Nordhausen ohne Unredlichkeit kaum jemand überhaupt imstande sei, so en gros einzukaufen. Deshalb wurden eigens 2 Ratmannen ernannt, die zu prüfen hatten, ob ein solcher Handel auch wirklich ehrlich vor sich gegangen sei. Kompaniegeschäfte waren im allgemeinen überhaupt verboten. Beim Verkauf gesalzener Fische durfte nur ein Kompagnon angenommen werden. Ebenso war der Kettenhandel unterbunden. Der Kaufmann, der in Nordhausen verkaufte, sollte sogleich an die Bürger, nicht erst an Unterhändler verkaufen. Ferner dienten dem ökonomischen Gleichgewicht aller Bürger wichtige Bestimmungen über das Geben und Nehmen von Kredit. Unser modernerer Handel beruht ja gerade auf dem Kreditwesen, und dieses regt den Unternehmungsgeist des Einzelnen an, führt allerdings auch zur Armut auf der einen, zur Anhäufung ungesunden Reichtums auf der anderen Seite. Im Mittelalter war der Einkauf mit geliehenem Gelde im allgemeinen verboten. Schon 1308 wurde es verboten, Korn, Hopfen oder Wolle mit geborgtem Gelde zu erstehen, nur Bier durfte auf diese Weise gekauft werden. So konnte es zu einem Großkaufmannsstand kaum kommen.[14] Gehen alle diese Bestimmungen darauf aus, jedem sein täglich Brot zu sichern und keinen zu reich und mächtig werden zu lassen, so lassen sie doch erkennen, daß die sozialen Unterschiede zwischen den beiden sich politisch gegenüberstehenden Gruppen der Bürgerschaft, den Patriziern und Plebejern, durchaus nicht völlig verwischt waren. Sah man innerhalb der Gemeinschaft der Standesangehörigen auch auf möglichste Gleichheit, so sollte doch ein merkbarer Abstand zwischen vornehm und gering vorhanden sein. Aus diesem Grunde privilegierten die städtischen Statuten eine Innung, die der Gewandschnitter, der eigentlichen mercatores, stark. Bei ihnen war der Absatz nicht abhängig von ihrer Hände Arbeit, sondern sie verkauften nur von ihnen nicht hergestellte Waren, konnten deshalb leicht zu größeren Umsätzen gelangen als andere Handwerker und dadurch einen gewissen, allerdings durch die Nachfrage der nicht allzu kaufkräftigen Heimat begrenzten Reichtum aufhäufen. Die Gefreundten hatten in dem ersten Jahrhundert des Ratsregiments die politische Macht so gut wie allein in Händen und gebrauchten sie auch zu ihren persönlichen Vorteilen. Wo sie amtierten, im Rathause, hatten sie auch ihre Verkaufsstände, aus denen sie ihre Tuche verkauften. Besonders das mittlere und obere Stockwerk war ihnen vorbehalten, die unteren Gewölbe durften auch andere Händler mieten und dort ihre Waren feilhalten, niemals aber durfte es ein „Tücher“ sein, ein Kaufmann, der dieselben Waren verkaufte, wie die Gewandschnitter in den oberen Kammern. Auch gewisse Handwerker, die ähnliche oder gleiche Waren anfertigen und deshalb auch auf den Markt bringen konnten, wie sie sie verkauften, z. B. die Woll- und Leineweber, suchten sie als Konkurrenten durch Bestimmungen möglichst auszuschalten. Jeder Nordhäuser Bürger durfte bei diesen für sich und sein Gesinde Stoffe nur auf ein Jahr weben lassen. Der Handel wiederum mit nicht selbst gewirkten, sondern aufgekauften Tuchen war überhaupt jedem, der nicht Gewandschnitter war, verboten und verboten besonders auch der Verschnitt solches auf unrechtmäßige Weise erworbenen Tuches. Am eigenartigsten berührt aber die Bestimmung, daß kein Bürger auf seinen Leib Geld leihen durfte, daß sich also niemand in Schuldknechtschaft begeben durfte außer bei einem „unsen bürgen ufdem hüs“, d. h. also bei den Ratsherren, den Patriziern, die vornehmlich aus Gewandschnittem bestanden. Jedem, außer ihnen, war es verboten, Bürger in persönliche Abhängigkeit von sich zu bringen. Bürger zwischen 40 und 50 Jahren erhielten 10 Mark geliehen bei einem jährlichen Zins von 1 Mark, zwischen 50 und 60 Jahren 8 Mark, und bei noch älteren entschied der Rat, wie hoch die ihnen geliehene Summe sein durfte, für die sie jährlich 1 Mark Zins zu zahlen hatten. Da den Leuten meist nicht mit Geld, sondern mit Nahrungsmitteln gedient war, wurde zugleich der Marktscheffel Getreide auf 8 Mark festgesetzt, den die in Abhängigkeit Geratenen durch einen jährlichen Zins von einer Mark abzahlen mußten.[15] So sorgte der Rat bei aller Mittelstandspolitik doch dafür, daß er nicht zu kurz kam. Vor allem ließ er es sich aber angelegen sein, den Handel seiner Bürger vor fremder Konkurrenz zu schützen. Die Fremden besaßen in Nordhausen nur zu den beiden Jahrmärkten, dem Frühjahrs- und dem Herbstmarkte, volle Verkaufsfreiheit. Dann war auch der Zoll für die Waren herabgesetzt, und somit waren die Jahrmarkts tage die Tage, an denen ihnen völlige Gleichberechtigung mit den Einheimischen gewährt war. Dafür, daß sie nicht gar zu lange in Konkurrenz mit dem heimischen Markte traten, sorgten schon die Zünfte, die den Stadtbüttel eigens dafür besoldeten, daß er nicht zuließ, daß die Fremden noch nach Schluß des Jahrmarktes in ihren Buden verkauften. Auf den Wochenmärkten, die zunächst nur sonnabends, aber schon seit Mitte des 14. Jahrhunderts auch dienstags[16] stattfanden, waren fremde Händler, abgesehen von Lebensmittelverkäufem, meistens Hökern, nicht zugelassen. Nur eine Innung hatte hier zu ihrem Leidwesen mit der Konkurrenz des flachen Landes zu kämpfen, die der Fleischer. Daß sie diese nur unwillig ertrugen, einmal sogar tätlich gegen die ungern gesehenen Gäste vorgingen und deshalb vom Rate ums Jahr 1360 etwa 50 Fleischerfamilien aus Nordhausen verbannt wurden, beweist die Hartnäckigkeit, mit der die einheimischen Händler eine Monopolstellung zu wahren oder zu erstreben suchten. Doch diese Bestrebungen fanden an der richtigen Erkenntnis des Rates eine Schranke, daß sich die Bürgerschaft für die lebensnotwendigen Artikel keine allmächtige Monopolstellung gefallen lassen konnte. Deshalb war auch den Bäckern geboten, stets genügend Brot auf ihren Verkaufbänken zu haben, und um Lebensmittel eher in die Stadt hineinzubekommen als solche hinausgehen zu lassen, durften die Höker Eier, Butter und Käse im Weichbilde der Stadt nicht aufkaufen. Ausdrücklich wird in den Einungen als Grundsatz aufgestellt: Die Märkte, die der Rat und die Räte und die Vierteile und die Handwerksmeister eingesetzt haben, müssen allen, reich und arm, zugute kommen. Es ist unverkennbar, daß der Rat, wenn er auch hier und da einzelne Standesorganisationen bevorzugte, im allgemeinen doch das Bestreben hatte, die Sonderinteressen denen der Allgemeinheit unterzuordnen. Danach standen die Fremden unter ständiger Aufsicht der Marktpolizei. Besonders war streng der wilde Handel auf der Straße oder in den Absteigequartieren der Fremden untersagt. Ja, um diesen der Marktaufsicht sich entziehenden Handel zu unterbinden, war es den Wirten sogar verboten, solche zu beherbergen. Fremde durften rechtsgültige Geschäfte nur im Wagehause abschließen. Fremden Krämern war zwar das Feilhalten ihrer Waren an einer Kirche gestattet, aber nicht länger als zwei Tage nacheinander. Es ist jedoch interessant, daß der Rat im Ubertretungsfalle nicht selbst die Missetäter bestrafte, sondern es der Innung der Krämer überließ, die Fremden zu vertreiben; offenbar war also dieses Statut eine Konzession an die angesehene Krämerzunft, doch suchte der Rat, indem er sich weigerte, selbst einzugreifen, die Auswirkungen des Monopols der Krämer nach Möglichkeit zu verhindern. – Die Marktpolizei handhabte im Auftrage des Rates ein Marktmeister. Neben der Überwachung des Handels gehörte zu den Obliegenheiten der Marktpolizei die Beaufsichtigung der Gewerbe. Die Gewerbetreibenden waren in Zünften oder Innungen zusammengeschlossen, deren das Schultheißenbuch aus der Zeit um 1300 elf nennt; sechs und nach Hinzutritt der Schneider sieben Zünfte wählten nach 1350 einen Vertreter in den Rat, neun Zünfte besetzten später den Rat mit je zwei ihrer Zunftmeister. Das äußerst blühende Braugewerbe war nicht zunftgemäß zusammengeschlossen, die Tagelöhner, zu denen auch die Bauhandwerker gehörten, bildeten keine Zunft. Müller, Schäfer, Barbiere und Scharfrichter waren überhaupt unehrliche Leute. Die älteste Aufsichtsbehörde für alle Gewerbe war der Schultheiß; doch trat dieser die eigentliche Überwachung schon vor 1300 an den Rat ab. Da dieser aber zunächst aus ackerbau- und handeltreibenden Patriziern bestand, kümmerte er sich um die Gewerbe nur wenig. Die älteste Einung setzte allein für das Braugewerbe fest, daß kein Bürger jährlich mehr als 20 Fuder Bier brauen durfte. Eine andere Bestimmung setzte als Höchstpreis, den die Krämer für Messer nehmen durften, 3 Scherf fest. Das sind die einzigen Zeugnisse für die Bemühungen des ältesten Rates der Stadt Nordhausen um das Gewerbe. Dennoch waren natürlich schon Marktgesetze für die Anfertigung und den Vertrieb der einzelnen Erzeugnisse der Handwerke da. Nur war es den Zünften selbst überlassen, über ihre Beobachtung zu wachen. Bald aber, spätestens zu Beginn des 14. Jahrhunderts, mußte die städtische Obrigkeit dazu übergehen, ihre Aufmerksamkeit dem ganzen Gewerbebetriebe zuzuwenden. Bei fortschreitender Komplizierung des Handwerks und Gewerbes mußte von dem Rat als Zentralbehörde doch die ganze Regelung ausgehen, um der Gesamtheit der Bürgerschaft gerecht zu werden und um das Ansehen Nordhausens als Marktplatz für die umwohnende Bevölkerung zu wahren. Diese wirtschaftlichen Aufgaben, die damit an den Rat herantraten, waren aber auch von politischen Folgen begleitet. Genau so wie der Schultheiß, als er den Handel nicht mehr überblicken konnte, die reichen Kaufmannsfamilien zu seiner Beratung heranzog, so mußten die Kaufleute nunmehr Handwerker als Marktbeamte neben sich zulassen. Der Rat dehnte seinen Einfluß auf die Gewerbe aus, diese verlangten aber auch Berechtigungen gegenüber dem Ratsregimente. Anteil an der wirtschaftlichen Regelung bedeutet stets Zuerkennung politischer Rechte. Gegen Übergriffe der Handwerker suchte man sich im 14. Jahrhundert aber noch dadurch zu sichern, daß man den Handwerksmeister mit der hohen Strafe von 1 Jahr Gefängnis und 2 Mark Geldstrafe belegte, der Briefe öffnete, die an ihn in seiner Eigenschaft als städtische Vertrauensperson gerichtet waren. Dieses Statut hat sich übrigens auch nach dem Sturz der alten Geschlechter weiter erhalten, und noch im 18. Jahrhundert wurden Handwerksmeister, die Briefe widerrechtlich öffneten und nicht sofort dem Rate brachten, gebüßt, wenn auch nur mit einer Polizeistrafe. So wurden denn am Anfang des 14. Jahrhunderts 6 Handwerksmeister als Gehilfen des Rates ausersehen, um die Mitte des Jahrhunderts erhielten sie im Rate Sitz und Stimme, und 1375 rissen die Handwerker die politische Macht überhaupt an sich. Der Rat unter Mitwirkung der Zünfte übte also die Gewerbepolizei aus. Diese ging in erster Linie auf die Sicherstellung der Ernährung der städtischen Bevölkerung, auf Preisregulierung und auf Überwachung der Materialverarbeitung aus. Die beiden wichtigsten Gewerbe für den Lebensunterhalt waren die Bäcker und die Fleischer. Auf sie war deshalb das Augenmerk des Rates besonders gerichtet. Ihre Zunftmeister mußten darauf sehen, daß das Brot auf den Brotbänken nicht ausging und daß es redlich jedem, arm und reich, verkauft wurde. Bei größeren Verkäufen mußten die Bäcker den Käufern Zugaben gestatten, ein Brauch, der sich gerade bei diesem Gewerbe bis in die neueste Zeit gehalten hat. Den Fleischern wiederum war nicht die Bestimmung auferlegt, ständig frisches Fleisch in ihren Buden in der Schmergasse und dem nördlichen Ende des Steinweges zu haben, dafür ließ aber der Rat zum großen Unwillen der Zunftgenossen auf dem Markte auswärtige Konkurrenz zu, damit es niemals an Fleisch in der Stadt mangele. Auch wurde darauf gehalten, daß nur gutes und gesundes Fleisch verkauft, zu Würsten nur das Fleischgut, nicht etwa Kutteln und Eingeweide, verarbeitet würde. Diese Überwachung des durch die Handwerker verarbeiteten Materials traf auch die anderen Gewerbe, besonders Gerber, Schuster, Goldschmiede und Kannengießer. So durften die Goldschmiede nur reines, lötiges Silber verarbeiten und mußten dem Käufer die Menge Goldes, die sie zum Verarbeiten bekommen hatten, in der Fertigware wieder zustellen; die Kannengießer durften bei der Verarbeitung zu 10 Pfund Zinn nicht mehr als 1 Pfund Blei zusetzen. In die Preisregulierung scheint der Rat weniger eingegriffen zu haben. Abgesehen von unbedeutenderen Preisfestsetzungen für Krämer, Becherer und Bäcker finden sich für die in Zünften zusammengeschlossenen Handwerker selten dergleichen Bestimmungen. Im allgemeinen blieb es den Zünften selbst überlassen, die Preise für die Waren anzusetzen. Desto mehr ließ es sich aber der Rat angelegen sein, den Arbeitslohn für Tagelöhner aller Art festzusetzen. Es wurde genau angegeben, was ein Steinmetz, ein Ziegeldecker, ein Zimmermann, ein Tagewerker, ein Höker, ein Bierschröter täglich zu beanspruchen hatte. Die Höhe des Lohnes war bei gelernten Arbeitern durchaus angemessen, bei den Tagelöhnern aber so, daß die Leute wahrlich nicht übermütig werden konnten. Selbst die Kost, die täglich zu geben war, wurde vorgeschrieben, und jedem 10 Schilling Strafe angedroht, der etwa die festgelegten Sätze überschritt. Verweigerung der Arbeit, die man den Leuten bei dem Hungerlohne eigentlich nicht verdenken konnte, war verboten und wurde mit 5 Schilling oder einem Tage Halseisenstehen bestraft. So ist festzustellen, daß auf Grund seines Rechtes am Markte der Rat wie über den Handel, so auch über das Gewerbe seine Hand hielt. Er benutzte aber zur Beaufsichtigung der Handwerker die von diesen selbst geschaffenen Organisationen und verpflichtete sie sich dadurch. So kam es, daß die Vertrauenspersonen der Zünfte zugleich die Vertrauenspersonen des Rates werden mußten, daß sich ihre wirtschaftlichen und politischen Funktionen verquickten und daß die Organisationen, denen sie entstammten, die Zünfte, selber solche Zwitterstellung bekamen. Die Handwerker waren in wirtschaftspolitischer Beziehung zunächst ihrem die Stadt beratenden Zunftmeister zu Gehorsam verpflichtet; die Zünfte selbst bekamen von den Strafgeldern ihrer Mitglieder wegen Überschreiten der Gewerbeordnung einen Teil; den anderen zog der Rat ein. Die erste Instanz für Zunftangelegenheiten war die Zunft selbst. Die Berufungsinstanz war der Rat. Je geringere Bedeutung ein Gewerbe für die Allgemeinheit hatte, desto größere wirtschaftliche Freiheit besaß es; je wichtiger es für die Gesamtheit der Bürger war, desto größer war seine Beaufsichtigung durch den Rat. Überall aber ließen sich die politischen Behörden von den wirtschaftlichen beraten, und diese bekamen dadurch mit Naturnotwendigkeit politischen Einfluß und politische Rechte. War nun aber auch der Markt und die ummauerte Stadt mit ihren wirtschaftlichen Verhältnissen der Ausgangspunkt für das Stadtregiment und für alle politischen Änderungen in demselben, so war doch das Leben der Nordhäuser Bevölkerung dadurch nicht allein bedingt. Ganz abgesehen davon, daß die meisten Bürger bei ihrem Hause Gartenland besaßen und auch Vieh hielten, welches sie durch den städtischen Hirten auf die Weide treiben ließen, gab es auch zahlreiche Bürger, die neben ihrem Gewerbe eine kleine Landwirtschaft betrieben, gab es sogar, wenn auch in geringerer Anzahl, Bürger, die sich allein von Ackerbau nährten. Diese ländliche Betätigung der städtischen Bevölkerung hielt man durchaus der Beachtung wert, sicherte sie doch wenigstens zum großen Teile die Unabhängigkeit der Stadt von den Dorfschaften der Umgebung. Und der Rat mußte umso mehr darauf Bedacht nehmen, die Landwirtschaft und Viehzucht des einzelnen Bürgers zu schützen, als die Stadt Nordhausen selbst, im Gegensatz zu anderen Städten ihres Charakters, so gut wie gar keine Ländereien und Forsten besaß. Vom Besitz weiträumiger Äcker träumten deshalb die hochfahrenden Patriziergeschlechter am liebsten, und als Ziel ihrer Wünsche und ihres politischen Ehrgeizes gaben sie deshalb schon Anfang des 14. Jahrhunderts alles Gebiet an innerhalb der Dörfer Bielen, Sundhausen, Steinbrücken, Rieterode, Groß- und Kleinwerther, Hesserode, Herreden, des Forstes des Kohnsteins, der Furt über die Zorge, Crimderode, Petersdorf und Leimbach. In den sechziger Jahren des 14. Jahrhunderts war man nahe daran, den Traum zu verwirklichen. Jedenfalls spielte in Nordhausen zu allen Zeiten die Begrenztheit der Stadtflur eine Rolle bei der Einschätzung ländlichen Besitzes. Die Statuten zeigen, daß der Rat die Aufsicht über das Feld mit kaum geringerer Sorgfalt ausübte als über den Markt. Eine ganze Reihe polizeilicher Bestimmungen beweisen das. Den Schäfern war die Beachtung der Weidevorschriften auferlegt. Felddiebstahl war streng verboten, jeder Bürger mußte an den Toren offen zeigen, was er von draußen hereintrug, die Benutzung von durch fremde Flur führenden Wegen zum Viehtreiben oder Fahren war untersagt. Damit durch Nachlässigkeit oder Mißwirtschäft keine Frucht verloren gehe, durften die Seile für die Garben nicht aus Halmen mit Ähren gedreht werden, durfte die Frucht nicht unreif abgeemtet, das Futter nicht zu früh geschnitten werden. Knechten und Mägden aber, die Korn von der Ernte ihres Herrn veruntreuten, sollte man „bumen dorch die backen“, sollte man durch die Wangen brennen, der einzige Fall, in welchem die Statuten eine schwere körperliche Züchtigung androhen. Der Rat ernannte aus seiner Mitte eigens zwei „Ackermeister“, die über die Handhabung der Feldpolizei und über die Beobachtung der Vorschriften zu wachen hatten. Die geringen Ausdehnungen der Stadtflur, die Begrenztheit des städtischen Besitzes machen es auch verständlich, wenn der Rat ängstlich darauf bedacht war, wenigstens den vorhandenen Besitz festzuhalten und für die Stadt Vorteil daraus zu ziehen. Kein Bürger durfte Anwesen oder Ackerland verkaufen, verleihen, vermieten, so daß die Stadt keinen Nutzen mehr davon hatte. Konnte der Bürger sein Gut in der Feldmark nicht selbst bestellen, so sollte er es gegen Komzins verpachten; jede andere Verfügung darüber war ihm verboten. Noch größer war die Besorgnis, städtischer Grund und Boden könnte in geistlichen Besitz übergehen und damit dem Zugriff der Stadt entzogen werden. Die ältesten uns überkommenen Statuten übernehmen schon aus dem ersten, nicht erhaltenen Stadtrecht das strenge Gesetz, jeder verliere sein Leben und Gut, wer seinen Besitz der geistlichen Hand vermachte, doch mäßigten sie selbst die Bestimmung durch ein anderes Gesetz am Schlüsse der Statuten, daß jeder die Stadt räumen müsse, bis er das der Kirche vermachte Gut der Stadt wieder zugebracht hätte. Ja, nicht bloß liegende Güter, sondern überhaupt jede Habe sollte der gewaltig um sich greifenden Kirche entzogen werden: der Bürger, der eines seiner Kinder in ein Kloster zu geben beabsichtigte, mußte es der Stadt anzeigen, und das Kind selbst mußte vor dem Rate auf seinen Erbteil verzichten. Enthalten nun auch andere Stadtrechte ähnliche Bestimmungen, so drückt sich doch in dem von Nordhausen ganz besonders aus, daß man mit dem Pfennig zu rechnen hatte. War der Verkehr in der Stadt auch ziemlich bedeutend und beschränkte er sich auch durchaus nicht auf den Güteraustausch innerhalb der nordthüringischen Heimat, so fehlte der Stadt doch das rechte Rückgrat, es fehlte ihr ein größerer Eigenbesitz. Nicht Handel und Gewerbe begrenzten die wirtschaftlichen Möglichkeiten, sondern die kleine Feldflur und der geringe Grundbesitz der Bürger. Deshalb waren naturgemäß auch die Lasten begrenzt, welche der Rat seinen Bürgern auferlegen konnte. Freilich, die eigentliche Verwaltung verursachte wenig Ausgaben. Sie geschah teils ehrenamtlich, teils wurde ihr Apparat durch eine Anzahl kleiner Steuern in Gang gehalten: Wo die Stadt einem Einzelnen oder einer Körperschaft ihre Hilfe lieh, wo sie für diese oder jene Interessengemeinschaft etwas aufwandte, verlangte sie auch Abgaben. Auch ihre Beamten wurden großenteils auf diese Weise unterhalten; ihre Einkünfte setzten sich aus einer ganzen Reihe kleiner Posten zusammen. Doch erforderten natürlich viele Angelegenheiten der Stadt im Innern und ihre gesamte Vertretung nach außen hin auch eine zentrale Stelle, von der aus diese Ausgaben gedeckt wurden. Um diese städtische „Kämmerei“ zu speisen, erhob die Stadt von jedem Bürger Steuern. Mit ihrer Einziehung waren die beiden „Schoßherm“ betraut. Versäumnisse des Rates bei der Vereinnahmung der Steuern wurden bestraft. Im 13. Jahrhundert standen der Stadt nur sehr spärlich fließende Steuerquellen zur Verfügung, da alle namhaften indirekten Steuern, besonders die Zölle, dem Reiche gehörten und von den direkten Steuern die Gebäudesteuer, der Wortzins, dem Kreuzstifte zufloß. Diese letztere vermochte allerdings die Stadt in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts an sich zu reißen und war damit wenigstens Herrin aller direkten Steuern. Der Besteuerung unterworfen war alles „leginde Gut“ und „vamde habe“. Die Grundsteuer lag nicht nur auf dem Grundbesitz innerhalb von Stadt und Flur, sondern auch auf dem Besitze in anderen Ortschaften. Hatte jemand, der Bürger in Nordhausen war, in der Stadt selbst gar kein Gut, wohl aber außerhalb, so bezahlte er gleichfalls eine allerdings geringe Steuer „Zciu eime bekenntnisse seines borger rechtes“. Steuerhinterziehungen wurden mit Einziehung des Gutes, das nicht versteuert worden war, bestraft, ein Verfahren, das auch heute noch sehr angebracht und nachahmenswert wäre. Schien es, als ob der Bürger sein Vermögen und Einkommen zu niedrig veranschlagt habe, so wurde er zunächst darauf hingewiesen; leistete er dann aber einen Eid, daß seine Angaben stimmten, so durfte er nicht weiter verfolgt werden. Abgesehen von diesen Vermögenssteuern mußte eine Abgabe bei Verleihung des Bürgerrechts und beim Eintritt in eine Innung gezahlt werden; die 28 Pfennig für Verleihung an den Schultheißen und die jährliche Steuer an ihn brachten seit 1290 nur noch die Oberaufsicht des Kaisers zum Ausdruck. Die Verleihung des Bürgerrechtes war von besonderer Bedeutung für die Stadt, weil sie es dadurch in der Hand hatte, jeden als Bürger abzulehnen. Solche Vorsicht war vor allem Pfahlbürgern gegenüber geboten, die nicht selten abhängig von anderen Herren waren, mit denen dann die Stadt womöglich in Konflikt geriet. Nachdem gar die Goldbulle von Metz 1356 die Aufnahme von Pfahlbürgern überhaupt verboten hatte, fügten auch die Nordhäuser ihren Statuten ein Gesetz ein, daß keiner als Bürger aufgenommen werden dürfe, der in irgendeiner Abhängigkeit von einem adligen Herrn stehe. Auch sonst erhob die Stadt mancherlei Gebühren, von denen die einträglichste das Braugeld war. Alle Einnahmen und Ausgaben überwachten die 4 Kämmerer, Ratsherrn, welche man als die obersten Finanzbeamten der Stadt ansprechen kann. Sie hatten das vereinnahmte Geld in der Schatzkammer auf dem Rathause niederzulegen, zwei von ihnen verwalteten die Einnahmen, die beiden andern die Ausgaben. Diese letzteren durften nur gemacht werden, wenn drei Kämmerer sie übereinstimmend beschlossen. Bei Ausleihung von städtischem Gelde mußte der gesamte Rat gehört werden. Eng verbunden mit dem Steuerwesen ist stets die Ausübung der Sittenpolizei; wissen doch die Steuerkommissare am besten, welchen Aufwand der einzelne seinem Einkommen nach zu machen imstande ist. Daß das gesamte gesellschaftliche Treiben in früheren Jahrhunderten viel stärkerer Bevormundung als heute unterlag, ist bekannt. Da jedoch die Kirche das ganze Gebiet der Kultur für sich in Anspruch nahm, beschränkten sich bis zur Reformationszeit die Eingriffe des Staates darauf, dem Auftreten der bürgerlichen Gesellschaft ein möglichst einheitliches Gepräge zu geben. Wie die Kontrolle und Regulierung der Wirtschaft dauernd möglichst gleichbleibende Verhältnisse schaffen und jedem einzelnen einen möglichst gleichen Anteil am Wirtschaftsprozeß gewährleisten sollte, so waren auch die Bestrebungen der Sittenpolizei darauf gerichtet, daß keiner aus der Reihe tanzte. Der Wohlanstand erforderte für jeden Bürger einer bestimmten Gesellschaftsschicht eine möglichst gleichmäßige gesellschaftliche Haltung; Übertretungen wurden geahndet. Aus dieser Einstellung entspringen auch die Befugnisse des Nordhäuser Rates über die Sitten der Bürgerschaft. Aufwand und Geselligkeit der Bürgersöhne waren reguliert; die Töchter hatten sich auch bei der Wahl ihres Gatten als gehorsame Kinder dem Willen der Eltern zu fügen; Kleidervorschriften dienten dazu, daß keinem Hoffart nachgesagt werden konnte. Bürger und Bürgerinnen durften bis zu 1/2 M lötigen Silbers an ihren Kleidern tragen, nicht mehr. Von ihnen im gesellschaftlichen Range unterschieden waren die Dienstboten und die „unehelichen Wirtinnen“. Ihnen durften keine neu gewirkten Gewänder gegeben werden, Dienstmädchen durften an ihren Kleidern kein Silber tragen. Ebenso sollte es bei Festlichkeiten möglichst einheitlich hergehen; allzu große Ausgaben bei Kindtaufen, Hochzeiten, bei der Einkleidung von Knaben oder Mädchen für den geistlichen Stand oder bei der Feier der Festtage des Jahres waren untersagt; häufig wird sogar die Zahl der bei Festen gestatteten Schüsseln bestimmt. Auch das Betteln und Singen vor den Türen unterlag polizeilicher Aufsicht; zur Weihnachtszeit, am Bartholomäustage, zu den ausgelassenen Festen des Flachsraufens und der Hopfenlese war aufdringliches Betteln verboten. Schließlich unterlag auch der Wirtshausbesuch und besonders das Würfelspiel der städtischen Kontrolle. Natürlich übte der Rat auch die Baupolizei aus. Doch legte er sich dabei ganz im Gegensatz zum 17. und 18. Jahrhundert, wo eine Unmenge von baupolizeilichen Vorschriften erlassen wurden, große Zurückhaltung auf. Selbst die Aufsicht über das Aufschlagen der Buden auf dem Markte und die Herrichtung der dauernden Verkaufsstände, der Läden und ihrer Auslagen überließ er den Zünften. So findet sich denn in den gesamten Statuten eigentlich nur eine baupolizeiliche Verfügung: „Welch man in sime house setzet eynen bagoven, eynen hoben eder eyn heymelikeit, di sollen sten von der gebilwant dri vüze unde von der droufestat (Dachtraufe) drittehalben vuz“ Ferner war es aus hygienischen Gründen den Fleischern verboten, Schmutzwässer in die Gosse zu leiten und Schutt und Müll zwischen Töpfertor und Töpferteich abzuladen; Aas durfte nicht in den Teich geworfen werden. Beschäftigen sich nun auch die Statuten in erster Linie damit, Frieden, Recht und Ordnung innerhalb der Stadt zu gewährleisten, und haben wir deshalb bisher den Rat in dieser Hinsicht zugleich als gesetzgebende und ausübende Körperschaft kennengelemt, so vertraten doch auch nach dem Jahre 1220 allmählich die Herrn der Stadt alle ihre Belange voll Eifer nach außen hin. Bis 1277 hatten noch die Reichsministerialen über der Außenpolitik gewacht und ungern eine Anteilnähme der vornehmen Geschlechter zugelassen. Doch dann waren ihre Befugnisse in die Hände des Rates hinübergeglitten, und seitdem vertrat sich die Stadt in den vielen kleinen Händeln des Mittelalters selbst, schloß Verträge, ging Bündnisse ein, bestand Fehden, verfocht ihr Recht beim Kaiserlichen Hofgericht. Auch für jeden einzelnen seiner Untertanen trat der Rat ein, erwartete allerdings von ihm Ersatz der entstehenden Kosten. Ebenso verlangte er unbedingtes Solidaritätsgefühl der Bürger gegen die Feinde der Stadt: Wenn eine fremde Macht Nordhäuser Bürger geächtet oder beraubt oder wenn dieselbe von Nordhäusern Geächtete aufgenommen hatte, durfte kein Bürger mit ihr irgendwelchen Verkehr pflegen. Zum Schutze gegen auswärtige Feinde dienten die Mauern der Stadt. Diese im Stande zu halten und auszubauen war Pflicht des Rates. Deshalb waren zwei Ratmeister beauftragt, die Steinfuhren zu überwachen, die einerseits eine Reihe von der Stadt benachbarten Dörfern zu liefern hatte und welche andererseits die Stadt selbst aus den Steinbrüchen am südlichen Rande des Kohnsteins anfahren ließ. Ja, ein Statut verpflichtete jeden sitzenden Rat, immerfort am Ausbau der Mauer tätig zu sein, andernfalls jedem Ratsherrn eine Strafe von 1 M auferlegt würde. Ebenso hatte der Rat die Aufgabe, den Stadtgraben in ordnungsmäßigem Verteidigungszustande zu halten; Vieh durften die Bürger dort nicht weiden lassen. Im übrigen war jeder Bürger zu Angriff und Verteidigung mit der Waffe verpflichtet. Damit bei plötzlichem Kriegslärm keine Verwirrung entstehe, war jeder Bürger einer Rotte zugeteilt, zu der er sich zu begeben hatte, wenn zum Sturm geläutet wurde. Ratmannen führten die Scharen der Bürger an; denn damals war es noch Sitte, daß die Vertreter der Bürgerschaft nicht nur mit dem Munde, sondern auch mit der Tat die tüchtigsten waren. Jeder Bürger hatte sich je nach seinem Vermögen selbst zu bewaffnen; dabei waren vier Abstufungen vorgesehen. Neben dem Bürgeraufgebot warb die Stadt aber auch noch Söldner an und hielt sich seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts einen auswärtigen Edelmann als Stadthauptmann. Aus dem gesamten Rate als der gesetzgebenden Körperschaft wurde alljährlich am Tage des Ratswechsels, am Tage der Heiligen Drei Könige, jeder der ausführenden Beamten mit einem bestimmten Amte betraut. Die Ausübung geschah ehrenamtlich, doch erhielten die Ratmannen für gewisse außergewöhnliche Leistungen kleine Geschenke von der Stadt, zumeist nur in Wein und Semmelbrot, doch kamen auch Geldgeschenke vor. So erhielten z. B. die Kämmerer und Schoßherm für das Aufstellen des Etats, die sechs Spendenmeister für die Arbeit zum Spendetage, dem Freitage vor Palmarum, Gratifikationen. Deshalb mußten sie auch vor ihrer Amtsniederlegung die Rechtmäßigkeit der empfangenen Geschenke nachweisen. Natürlich gewährte die Stadt für Unterhalt und Auslagen während der Dienstreisen Aufwandsentschädigungen; doch scheint der Stadtsäckel von den Herrn zuweilen etwas stark in Anspruch genommen zu sein. Um 1350 verlangt daher ein Statut, daß jedesmal ein Ratmann mitreite, die baren Auslagen bezahle und darüber dann Rechnung ablege. Außerordentlich praktisch! Die glückliche Rückkehr von solchen Missionen gab in älterer Zeit zu einem ausgiebigen Festmahl auf Kosten der Stadt Anlaß; das wurde später untersagt. Im übrigen gestattete sich der Rat am Tage der Heiligen Drei Könige ein Festessen auf Kosten der Allgemeinheit. 1456 wurde es abgeschafft. Für den Ausfall erhielt fortan jeder Ratsherr ein Stübchen Wein, ein Semmelbrot und ein Schilling Groschen; die Bürgermeister erhielten das doppelte.[17] Frühzeitig war die Stadt aber auch gezwungen, ihre Geschäfte neben diesen ehrenamtlich tätigen Männern durch angestellte und festbesoldete Beamte besorgen zu lassen. Abgesehen von den Stadtknechten, die als Polizisten, Markthelfer, Austräger, Torknechte Dienst taten, ist als vornehmster Beamter seit der Mitte des 14. Jahrhunderts der Stadtoberschreiber oder Syndikus zu erwähnen. Dieser Mann, der die Stadt vor allem rechtlich beriet, wurde zunächst aus den Patriziergeschlechtern genommen. Doch beweist eine Bestimmung aus der Mitte des 14. Jahrhunderts schon die sich ankündigende Demokratisierung: „Ouch sal der rat und di rete vortme (fortan) nicheynen schriber nemen, der eyn gefrunt man si in der stat, sondern sie sollen eynen nemen, der eyn gemeyne man si.“ Später holte man sich auch rechts- und weltkundige Leute von auswärts als Syndici. Dieser Stadtoberschreiber erhielt im 14. Jahrhundert 8 Mk. Gehalt und 12 Ellen Tuch, dazu 100 Pfennige als Geschenk. Für eine ganze Reihe besonderer Leistungen bezog er außerdem entsprechende Entlohnung. Seit Beginn des 15. Jahrhunderts stand ihm noch ein Unterschreiber oder Sekretär zur Seite. So sehen wir denn: Abgesehen von den in den früheren Kapiteln geschilderten Einschränkungen durch die Vogtei und das Schultheißenamt war der Rat nur dem Reichsgesetz und Reichsgericht unterworfen, sonst regierte er in der freien Reichsstadt vollständig selbständig.[18] Liegt nun in den Bestimmungen der Statuten auch unzweifelhaft das Schwergewicht bei Handel und Gewerbe, so weisen sie doch eine Reihe von Gesetzen auf, die erkennen lassen, wie wertvoll jenen Geschlechtern der Besitz von Ackerland war. Die Nordhäuser Stadtflur war sehr klein, das Gewerbe aber, aus dem die Bürger besonderen Vorteil zogen, das Braugewerbe, war durchaus abhängig von der Gewinnung von Körnerfrucht und Hopfen. Und wenn auch die eigene Stadtflur den Bedarf niemals allein decken konnte, – es war doch wünschenswert, möglichst unabhängig von draußen, besonders von der nicht selten sich feindlich stellenden Grafschaft Honstein zu sein. Die vornehmen Geschlechter, die ausnahmslos Braugerechtsame besaßen, mußten deshalb darauf bedacht sein, den Landbesitz der Stadt zu vergrößern. Dazu kam ihre Verbundenheit mit dem Lande, die vielen von ihnen von jener Zeit her im Blute lag, da sie noch auf ihren Dörfern saßen und den Acker bestellten. So mag sich manchem der wohlhabenden Gewandschnitter und Brauherm die Brust geweitet haben, wenn er durch Wein und Komwuchs, Hopfen und Hackfrucht reiten konnte. Aber auf wie engem Gebiete! Kaum war der Gaul bestiegen, da rannte seine Nase schon gegen einen honsteinschen Schlagbaum. Und das sollte einen tatkräftigen Mann nicht ärgern, der das Zeug in sich fühlte, in viel weiterem Wirkungskreis zu stehen, als ihm zugemessen war! Dieser Tatendrang, dieses Selbstbewußtsein eines jugendlichen, gesunden Geschlechtes war das Entscheidende, was den Nordhäuser Rat im 14. Jahrhundert zu einer großartigen Expansionspolitik drängte. Und um sich dehnen zu können, um die Stadtflur zu erweitern, um seiner Waffenlust genüge zu tun, um für die Zukunft Vorteile zu erringen, scheute man keine augenblicklichen Opfer. Das aber bezeichnet stets den Unterschied zwischen einer kleinlichen, engstirnigen, schließlich doch geprellten und einer großzügigen, weitblickenden, schließlich zum Erfolge führenden Politik, daß eine solche Opfer und Entbehrung in der Gegenwart erträgt im Hinblick auf eine ertragreiche Zukunft. Diese Erkenntnis der Grundeinstellung des aristokratischen Regimentes in Nordhausen zu Beginn des 14. Jahrhunderts ist schließlich wertvoller als die bloße Kenntnis vom Zustandekommen der heutigen Stadtflur. Unzweifelhaft hat Karl Meyer für die Geschichte unserer Stadtflur das bedeutendste geleistet. Vieles seht freilich heute noch auf recht unsicheren Füßen, manches wird immer im Dunkel bleiben. Deshalb ist es nötig, noch mehr als bisher das einwandfrei Feststehende von dem nur Vermuteten zu scheiden. Bei der Gründung der Burg Nordhausen muß Heinrich I. dem Wirtschaftshofe den größten Teil der Flur Altnordhausen zugesprochen haben, und zwar den nordöstlichen Teil, auf dem auch die Altstadt steht und der vom westlichen Steilrand am Mühlgraben bis an den Holbach (Rössings- oder Roßmannsbach) im Osten reichte. Die Flur Altnordhausens ging im Süden auch über die Zorge hinfort; dieser Teil muß aber im Besitze der alten Siedlung geblieben und um 1200 größtenteils in den Besitz des Frauenbergklosters übergegangen sein. Die Befugnisse der alten Reichsvögte darüber sind ganz unklar: jedenfalls haben die Honsteiner Grafen nach dem Tode des letzten Vogts Ruprecht Ansprüche auf diesen südlichen Teil der Flur geltend gemacht. Sie besaßen noch im 15. Jahrhundert gewisse Schutzrechte über das Frauenbergkloster. An dieses Flurgebiet hat vielleicht im Nordwesten die Flur des Dörfchens Hohenrode gegrenzt. Doch befinden wir uns hier auf ganz schwankendem Boden. Eine kleine Siedlung hat sicher seit uralten Zeiten am Nordrande des Geiersberges gelegen; sicher bezeugt aber ist sie nicht. Noch weniger kann natürlich ihre Flur festgestellt werden. Nur das ist gewiß, daß das Gebiet zwischen dem Zuge der heutigen Kranich- und Töpferstraße im Süden, dem Zorgelauf bis ans Schurzfell im Westen, dem Kuhberg und Tütcheröder Berg im Norden und dem Laufe der heutigen Stolberger Landstraße im Osten sehr früh zur Nordhäuser Stadtflur gehört hat. Meyer läßt ja Hohenrode kurz nach 1220 eingehen und dieses Gebiet, das er für die Hohenröder Feldmark ansieht, an Nordhausen fallen; das ist mit Gewißheit nicht auszumachen. Vielleicht ist es nicht von der Hand zu weisen, daß Altnordhausen schon viel früher, in fränkischer Zeit, einen Streifen Landes im Zorgegrunde an den Abhängen des Geiersberges, des Wilden Hölzchens und des Kuhberges um des Mühlgrabens willen besessen hat und daß die bewaldeten Höhenrücken nördlich und südlich der Gumpe Reichsbesitz waren, die dann von den Kaisern zur Urbarmachung der Reichsstadt überlassen wurden. Ebenso wenig gesichert sind die Forschungsergebnisse von dem Lande zwischen dem Töpfertor und der Windlücke. Auf dieser Flur hat nach Meyers Feststellung am Ausgange des Bomtales das Dörfchen Gumprechterode oder Benderode gelegen. Schon der doppelte Name ist merkwürdig, und Benderode als Abkürzung für Gumprechterode anzusehen, leuchtet wenig ein. Urkundlich belegt ist nur, daß hier ein Dörfchen Gumprechterode 200 Morgen (6 1/2, später 7 Hufen) Land besessen und allmählich durch Urbarmachung weiterer Ländereien Gebiet bis an die Windlücke und den Roßmannsbach gewonnen hat. Man wird mit Meyer annehmen dürfen, daß das Dorf 1294 eingegangen ist und seine Bewohner nach Nordhausen geflüchtet sind. Die Gerichtsbarkeit über diese Feldmark besaßen die Honsteiner, die Äcker waren aber im Besitz der Bauern und späteren Nordhäuser Bürger. Durchaus einleuchtend hat Meyer klargelegt, daß die rechtlichen Verhältnisse in der Zeit, wo die Honsteiner bis zum Jahre 1342 auch das Schultheißenamt in Nordhausen besaßen, unklar geworden sind. Derselbe Schultheiß hatte damals sowohl die Aufsicht über die eigentliche Stadtflur wie über Honsteinsches Herrschaftsgebiet. Als dann den Honsteinem das Schulzenamt genommen wurde, beanspruchten die Nordhäuser, deren Mitbürger die Feldflur ja im Besitz, aber nicht innerhalb der städtischen Grenzen hatten, diese Feldmark auch als städtisches Gebiet, in dem der Rat Polizei- und Gerichtsbarkeit besaß. Im 14. Jahrhundert scheinen die Honsteiner deshalb keinen Einspruch erhoben zu haben; im 15. Jahrhundert kam es aber zwischen ihren Rechtsnachfolgern, den Stolbergern und Schwarzburgem, einerseits und der Stadt andererseits zu unglücklichen Streitigkeiten, die erst 1464 beigelegt wurden. Viel klarer liegen die Verhältnisse im Süden und Westen Nordhausens. Hier war die Stadt am meisten eingeengt. Bis an den Mühlgraben hin, also bis unter die Burg reichte honsteinsches Gebiet. Das war um so drückender für die Bürger, als sich gerade hier unter dem Steilabfall mehrere neue kleine Stadtteile gebildet hatten. Der Sand, die Flickengasse und der Grimmel müssen sich gegen Ausgang des 13. Jahrhunderts besiedelt haben, und man kann auch hier annehmen, daß die Vertreibung der Bevölkerung des größeren Dorfes Niedersalza und des kleineren Niederrode im Jahre 1294 den Hauptanstoß zu der Niederlassung unter den Stadtmauern gegeben hat. Von ihren neuen Wohnsitzen aus bewirtschaftete die Bevölkerung weiterhin ihre ehemaligen Fluren, doch war der gesamte Grund und Boden honsteinsches Eigentum. Um nun wenigstens die Wohnstätten jener Siedler dem Stadtgebiet zu gewinnen, schloß am 23. Juni 1315 die Stadt mit dem Grafen Heinrich IV. und Dietrich III. von Honstein einen Vertrag, nach dem Nordhausen für 100 Mk Silber einen rings um die Stadt gelegenen und durch Grenzsteine bezeichneten Streifen Landes von den Honsteinem erwarb. Die wesentlichsten Teile, die damals erworben worden sind, müssen die zwischen der Stadtmauer im Westen und dem Flußbett der Zorge gewesen sein; doch erstreckte sich der Erwerb, wie aus dem „rings um die Stadt“ hervorgeht, auch noch auf andere Ländereien. Hierüber ist aber gar nichts auszumachen. Die Gerichtsbarkeit jenseits der Zorge über die alten Besitzungen der nunmehr zu Nordhäuser Bürgern gewordenen ehemaligen Bewohner von Niedersalza und Niederrode behielt Honstein. Vor der Zorgebrücke am Siechhofe hielten die Grafen ihr Gericht. Die Zuständigkeit Honsteins wurde erst um 1500 angezweifelt. Scharfsinnig hat Meyer nachgewiesen, wie es zu diesen Nordhäuser Ansprüchen gekommen ist. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hatten die Honsteiner nämlich die ihnen gehörigen Vogteirechte über Nordhausen an die Stadt verpfändet. Dadurch wurden die Rechtsverhältnisse verdunkelt, was zu langjährigen Streitigkeiten zwischen der Stadt und der Grafschaft führte. Erst 1543 erwarb die Stadt die Gerichtsbarkeit und dehnte ihr Stadtgebiet dadurch auch im Westen und Süden etwa bis zu den heutigen Grenzen aus.[19] So ungewiß aber auch vieles an dieser Flurgeschichte Nordhausens ist, so wunderschön beleuchtet sie doch den Kreislauf alles Irdischen: Fast das gesamte Gebiet von Nordhausen und seiner Umgebung hatte dem Kaiser gehört. Für Nordhausen, Niedersalza und Gumprechtrode steht es fest, daß sie auf dem Boden des Reichs gelegen haben. Später betrachteten die Grafen das, was sie ursprünglich vom Reiche nur als Lehen hatten oder worüber sie nur gewisse Aufsichtsbefugnisse besaßen, als ihr Eigentum. So wurden die Besitzungen dem Reich entfremdet. Mit dem Aufkommen der Städte versuchten diese von den adligen Besitzern möglichst große Gebiete um die Stadt herum an sich zu bringen. Das geschah häufig durch Kauf, zuweilen aber auch widerrechtlich. Schließlich, seit dem 16. Jahrhundert, riß wiederum die nicht zum wenigsten durch die Geldwirtschaft und das Städtewesen erstarkte Fürstenmacht ein Recht nach dem anderen an sich, so daß, wenn nun auch an Stelle der kaiserlichen Zentralgewalt die fürstlichen Teilgewalten getreten waren, doch wieder die Jurisdiktion in die Hände der Landesherren hinüberglitt. Damit war der Ring geschlossen. Was Nordhausen angeht, so tritt jedenfalls die auf weite Sicht geführte Politik der Patrizier schon bei Betrachtung der Nordhäuser Flurverhältnisse zu Tage. Nachdem die Befugnisse der kaiserlichen Aufsichtsbeamten beseitigt worden waren, nachdem der Rat die Verwaltung der Stadt in die eigene Hand bekommen hatte, ging er sogleich auf eine bedeutungsvolle Expansionspolitik aus. Unglückliche Ereignisse für die Umgebung wie der Verwüstungszug Adolfs von Nassau förderten dabei die Stadt. Die Erwerbungen des Jahres 1315 sind an die Katastrophe des Jahres 1294 gebunden. Schwere und zähe Arbeit mußte dann allerdings geleistet werden, um den Honsteinem bald dieses, bald jenes Stückchen Land abzuringen. 50 Jahre später war man fast am Ziel: Von Herreden im Nordwest bis Bielen im Südost, von Petersdorf im Nordosten bis Steinbrücken im Südwesten sollte alles Nordhäuser Land sein. Da riß der zu straff gespannte Bogen, und nur einiges blieb im Besitze Nordhausens. Eine solche Politik läßt freilich weder langfristige Ruhe noch auch nur eine Atempause zu, sie muß stets bereit sein zu Angriff und Verteidigung. Nun, die Ratsherrn, die damals städtische Politik machten, waren ein wehrhaftes Geschlecht in einer wehrhaften Stadt. Wir haben schon gesehen, wie das Kriegswesen der Stadt vom Vogt auf den Rat übergegangen war, und der Rat ließ es sich wahrlich angelegen sein, seine Stadt zu hegen und zu schützen. Vom ältesten Befestigungsring der Stadt ist früher gesprochen worden; wann die späteren Mauern, Tore und Türme, deren Überreste wir zum Teil noch heute in Nordhausen sehen, aufgeführt worden sind, ist schwer zu sagen. Äußerste Verwirrung in unserer Kenntnis ist aus dem Grunde entstanden, weil man nicht bedacht hat, daß die zahllosen Befestigungswerke der Stadt, die dreifache Mauer der eigentlichen Altstadt mit ihren Zinnen, die mannigfachen Wälle und Gräben und Türme der Vorstadt und der Feldflur nicht in wenigen Jahren geschaffen sind, sondern daß drei Jahrhunderte an ihnen gebaut haben. Nur diese falsche Vorstellung konnte zu der unhaltbaren Ansicht Karl Meyers führen, daß zwischen den Jahren 1226 und 1234 „die heutige Stadtmauer“ erbaut worden sei.[20] Vielleicht ist heute in ganz Deutschland überhaupt keine Stadtmauer mehr vorhanden, deren Alter bis an den Anfang des 13. Jahrhunderts zurückreicht. Die Reste des Nürnberger Mauerringes z. B. stammen aus dem 14. und 15. Jahrhundert; das Alter der meisten uns heute noch erhaltenen Türme, Pforten und Bastionen Nordhausens reicht nur bis ins 15. Jahrhundert zurück. Der zweite Forscher, der sich über die Nordhäuser Befestigungen geäußert hat, ist Julius Schmidt. Er wird mit seiner Ansicht, daß die heutige Stadtmauer erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden sei, der Wahrheit näherkommen, obgleich wir manche seiner Darlegungen auch nicht gelten lassen können.[21] Meyer wird zu seiner Ansicht dadurch verführt, daß er kurz nach 1220 einen bedeutenden Aufschwung der Stadt richtig erkannt hat. Daß aber damals schon der Petersberg und das Blasii-Viertel mit starken Steinmauern umgeben worden seien, dafür fehlt jedes Zeugnis. Dagegen muß der Adolfsche Raubkrieg im Jahre 1294, also 80 Jahre später als Meyer meint, einen kräftigen Anstoß zur Befestigung auch der bisher außerhalb der eigentlichen Mauer gelegenen Stadtteile gegeben haben. Unserer Meinung nach sind die Überreste der Befestigungen, die wir noch heute sehen, in dem langen Zeitraum von 1295-1487 entstanden. Den Urkunden nach sind drei Perioden des Mauerbaus genau zu erkennen. Die erste umfaßt etwa die Zeit von 1290-1330; es ist die erste Blütezeit des selbstbewußten Bürgertums. Damals muß der innere Mauerring vom Barfüßertor am Steilhang entlang nach der Kuttelpforte, von dort über den Primariusgraben nach dem Rautentore und im Südosten weiter, den Petersberg einschließend, nach dem Töpfertor gegangen sein. Vom Töpfertor kehrte dann die Mauer, den ganzen Hagen mitumfassend, nach dem Barfüßertore zurück. Von diesem Ringe werden am spätesten die Befestigungen am Neuen-Wegstore entstanden sein. 1310 war der Neue Weg schon mit Häusern bestanden, 1315 wurde wahrscheinlich die Eingemeindung herbeigeführt, 1322 wird zum ersten Male das Neue-Wegtor genannt. Diese erste Periode muß auch schon die Umschließung des Töpferviertels mit einer Steinmauer vorgenommen haben. Schmidt behauptet freilich, dieser Stadtteil sei erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts befestigt worden; bis 1441 habe das Töpfertor auf dem Kornmarkte gestanden. Es läßt sich aber mit vielen Zeugnissen beweisen, daß um 1300 der Ostring vom Rautentor über das Töpfertor zum Barfüßertor entstanden sein muß. Zwar wird es richtig sein, daß 1289 das Georgshospital auf dem Platze des heutigen Gasthauses von Sippel vor der Stadt angelegt worden ist –curia leprosum ante civitatem–. Aber schon standen hier überall Häuser, und 1308 ist das Töpferviertel eins der vier Viertel der Stadt, das sicher auch in den Bering einbezogen wurde. 1310 wird ferner das Blidenhaus, das Haus für die schweren Belagerungs- und Abwehrgeschütze der Stadt, auf dem Rähmenhofe am Nordabhange des Petersberges erwähnt. Die Bürger werden ihre Geschütze kaum in einem Hause außerhalb ihrer Mauern untergebracht haben: Weberstraße, Hundgasse und Töpferstraße werden also 1310 schon geschützt gewesen sein. 1370 ist auch der Kornmarkt vorhanden, und alle Befestigungen und Tore werden längst von ihm verschwunden gewesen sein, ja 1322 wird schon von der curia calcificum, dem Schuhmachergildehaus am Kornmarkt, berichtet, das die Gilde wahrscheinlich nicht direkt an das Tor gebaut haben wird. Ebenso beweisen der städtische Marstall auf dem Hagen, der 1322 erwähnt wird, und die Nachtigallenpforte der Stadtmauer in der Nähe des heutigen Bismarckdenkmals, daß eine wirkliche Steinmauer vom Töpfertore zum Barfüßertore in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts schon vorhanden war. Also vor 1322 war die Töpferstraße befestigt, und das Töpfertor lag damals schon zwischen der heutigen Wirtschaft von Kohlmann und der Buchhandlung von Homickel. Auch der tiefe Graben am Südostabhange des Petersberges am heutigen Rähmen ist zu dieser Zeit angelegt. In ihm durften die Juden ihre Toten bestatten. Wenn Schmidt dieses ganze östliche Befestigungswerk erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstehen läßt, verfällt er in denselben Fehler wie Meyer, indem er glaubt, alles sei in wenigen Jahrzehnten entstanden. Es soll niemals behauptet werden, daß schon um 1300 die gesamte dreifache Befestigung samt ihren Toren, Zinnen und Türmen angelegt worden sei, aber die Hauptmauer mit einigen stark befestigten Toren und einem Graben davor muß zu jener Zeit hergestellt worden sein. Die zweite Bauperiode setzte um 1365 mit der Eingemeindung der Neustadt ein. In dem damals zwischen den beiden Gemeinwesen geschlossenen Vertrage übernahm die Altstadt ausdrücklich die Verpflichtung, die Neustadt zu befestigen. Die rechtliche Grundlage zu dieser Ummauerung wurde 1368 durch eine Urkunde Kaiser Karls IV. geschaffen, der damals genehmigte, daß Nordhausen seine Vorstädte „gebessem, umgraben, umbmauem, weitem und vesten möge auf des Reiches Grund und Eigen“. Daraufhin wurde am Ausgang der sechziger Jahre die Neustadt südlich des Mühlgrabens und nördlich des Pferdeteiches an der heutigen Amoldstraße entlang durch einen Mauerzug mit fünf Türmen, von denen heute nur noch der Oßwaldsche steht, gesichert. Bald darauf wurde auch der Frauenberg geschützt. Diese älteste Ansiedlung auf Nordhäuser Boden hat nie im eigentlichen Bering gelegen. Das empfanden die Bewohner aufs schmerzlichste und gingen schon früh daran, sich durch Gräben und Verhaue eine eigene Befestigung zu schaffen. Nach der Eingemeindung übernahm es dann im Jahre 1299 die Stadt, den Frauenberg zu schützen. Deshalb schloß die Stadt mit dem Propste des Frauenbergklosters einen Vertrag, nach dem ihr ein Stück Land für Befestigungsanlagen überlassen wurde. Die weiteren Befestigungen entstanden nach 1365, wo eine Mauer geschaffen wurde, die beim inneren Bielentore begann, die Sangerhäuser Straße bis zum Frauenbergsplan und dann die Schafgasse entlang ging und sich schließlich nach Süden hinabzog bis zu der Mauer, welche die Neustadt im Süden schützte. Darüber hinaus wurde noch das Martini-Vorwerk befestigt und hier das äußere Sundhäuser Tor angelegt. Bald danach, bis etwa zum Jahre 1400, wurde die Südbefestigung der Neustadt über die Sandstraße hinfort bis ans Grimmeltor erweitert, d. h. also die Siedlung auf dem Sande, damals „zwischen den Brücken“ genannt, der Grimmel und die Flickengasse wurden umfriedet. Abgeschlossen wurde diese zweite Periode mit der Befestigung der Feldflur, die geschaffen wurde vor 1406, wo Heringen von den Nordhäusern belagert wurde. Von diesen Außenbefestigungen mögen genannt sein: Der „neue Graben“, der die Flurgrenze gegen Bielen und Sundhausen hin bezeichnete, der „Landgraben“, der von der Zorge beim Siechhof nach Süden gegen die Helme hin lief und an den noch die Landgrabenstraße erinnert, der „lange Graben“, der sich von der Zorge am Altentor nach Salza hin und bis auf den Holungsbügel erstreckte, und endlich der „Nordschlag“, der vom Nonnenteiche aus über den Kuhberg, Heidelberg, Tütcheröderberg bis an die Stolbergerstraße verlief. Warttürme standen auf dem Holungsbügel, über Wildes Hölzchen, vor der Windlücke und an der alten Heerstraße nach Wallhausen im Osten der Stadt. Die dritte Periode der Befestigung begann 1437 und endete 1487. Am 12. Dezember 1436 gestattete Kaiser Sigmund, sowohl die Stadt wie die Feldflur zu befestigen. In dieser Zeit entstand nunmehr, abgesehen von Verstärkungen der Feldanlagen, besonders der Ausbau der Hauptstadtmauer. Erst damals wurden die Torbefestigungen ausgebaut. An den Haupttoren der Stadt entstanden jedesmal zwei Tore hintereinander, ein inneres und ein äußeres. Auf diese Weise wurden das Rautentor und das Barfüßertor angelegt. Das äußere Tor wurde durch einen oder zwei Türme flankiert, so daß jeder von der Seite her beschossen werden konnte, der in feindlicher Absicht in das Tor eindringen wollte. Glückte es dem Feinde wirklich, dieses äußere Tor zu gewinnen, so war er in dem Raume zwischen den beiden Toren eingekeilt. Hier stand nun in der Mitte über dem inneren Tor ein weiterer Turm, von dem aus dem Angreifer ein heißer Gruß bereitet werden konnte. Die Anlage des Barfüßerturms begann im Jahre 1427, 1873 wurde der Turm abgebrochen. Das Rautentor wurde 1449 bis 1453 vom Steinmetzmeister Werner als Krummtor gebaut und damals zugleich die äußere, niedrige Mauer am Primariusgraben zwischen Rautentor und Kuttelpforte hergestellt. Derselbe Meister baute seit 1445 auch die Mauern zwischen Töpfertor und Barfüßertor dreifach aus, indem er, wie es üblich war, zunächst draußen eine Mauer aufzog, dann den Graben folgen ließ, dann am Grabenrande eine zweite Mauer und schließlich dahinter die Hauptmauer anlegte. Am stärksten befestigt wurde damals das Töpfertor. Dieses, auf völlig ebenem Gelände gelegen, war sehr leicht angreifbar und mußte deshalb besonders verwahrt werden. Es wurde 1441 mit einem hohen Turme überbaut, der 1712 ausbrannte, jedoch noch einmal errichtet wurde. Vor das Tor aber wurde in den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts noch ein mächtiges Rondel, das man fälschlich Zwinger nannte, gesetzt. Dieser runde Turm, der 15 Meter im Durchmesser aufwies und 5 große Schießscharten unten sowie 5 kleine im Obergeschoß hatte, gestattet ein Bestreichen der ganzen Umgebung und besonders der beiden Wege um ihn herum, die an das eigentliche Tor heranführten. In derselben Zeit des ausgehenden 15. Jahrhunderts wurden auf der Hauptmauer auch erst die vielen Zinnen angebracht, in deren oberes Stockwerk man vom Mauerumgange aus gelangen konnte und die allenthalben die Mauern stattlich überragten. Nach der Stadtseite zu waren diese Türmchen offen, damit sich der Feind in ihnen nicht festsetzen konnte, wenn es ihm wirklich gelungen war, einen dieser Trutztürme zu nehmen. Hinter diesen Mauern und Türmen lag nun Nordhausen selbst, wohlverwahrt. Es nahm in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts einen Aufschwung, der die stattlichste Zukunft erträumen ließ, doch die Blüte dauerte nicht an; schon im Ausgang des 14. Jahrhunderts überflügelte die Schwesterstadt Mühlhausen die Stadt am Südharze, und im 15. und 16. Jahrhundert hielt die Stagnation weiter an. Allerdings lag das vor allem an den Hauptheerstraßen im Mittelalter. Diese zogen sich im Westen und Osten an der Stadt vorbei, um den Harz zu umgehen, und ließen Nordhausen unberührt. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Zugehörigkeit zu dem ost-westlich orientierten Preußen zu wirken begann, kam es zu einem neuen Aufschwung. Nordhausen ward vor anderen Städten ein Verkehrsmittelpunkt und überflügelte dadurch die alte Nachbarin Mühlhausen. Soweit es aber die ganz anders als heute gearteten Verkehrsverhältnisse des Mittelalters gestatteten, ließ es sich der Rat angelegen sein, die Stadt zu fördern und vorwärts zu bringen. In der Tat müssen Streben und Wohlstand ganz außerordentlich gewesen sein, wenn man die Leistungen und Opfer jener Zeit auf allen Gebieten bedenkt. Die Wohlhabenheit einer Stadt spiegelt sich am besten in ihren Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen wieder. Von diesen vermögen wir nun zwar bis 1290 einige der hervorstechendsten zu erkennen, besitzen auch noch aus dem Übergang vom 12. zum 13. Jahrhundert jene paar in früheren Kapiteln genannten uralten Reste, aber die Mehrzahl der bedeutenden und auf uns gekommenen Gebäude stammt erst aus dem 14. Jahrhundert, weil man erst damals begann, Kirchen und Häuser aus festem Stein zu fügen. Das Haus, in welchem die vornehmen Gewandschnitter ihre Verkaufsstände hatten und ihre Zusammenkünfte abhielten, war zugleich der älteste Sitz des Rates. Karl Meyers Ansicht, daß dieses antiquum mercatorium, dieses alte Kaufhaus, am Ostende der Bäckerstraße gelegen habe, ist nicht von der Hand zu weisen. Doch schon in der Zeit, wo dieses älteste Rathaus Nordhausens im Jahre 1287 von den Walkenrieder Urkunden bezeugt ist, entstand ein neues Rathaus, in das die Gefreundten nun ihre Kaufstellen und Beratungen verlegten. Es ist das Verdienst J. Schmidts, mit dem Glauben Förstemanns aufgeräumt zu haben, dieses zweite Rathaus habe mitten auf dem heutigen Kornmarkt gestanden. Schmidt hat einwandfrei nachgewiesen, daß das Gebäude auf der Stelle, auf der noch heute das Rathaus steht, zwischen den Jahren 1277 und 1286 errichtet worden ist. Seit 1300 ist sein Name vielfach bezeugt. Es besaß 12 obere, 16 mittlere und 16 untere Kammern, in denen die Gewandschnitter ihre Tücher aufgestapelt liegen hatten. Im Jahre 1360 wurde ein Neubau errichtet und eine dem Heiligen Leichnam des Herrn geweihte Kapelle hineingebaut, in der die Ratsherren vor jeder Sitzung die Messe hörten. Der Vikar der Kapelle bezog seinen Unterhalt von 60 Morgen Land in der Nordhäuser Stadtflur. 1421 stiftete der Rat noch eine zweite Kapelle. Beide Vikare standen unter der Aufsicht der Marktkirche. Dieses im Jahre 1360 aufgeführte Rathaus hat bis 1608 gestanden, wo unter teilweiser Benutzung der alten Grundmauern und Steinquadern das heute noch vorhandene erbaut wurde.[22] Hinter dem Rathause lag die vornehmste Kirche der Bürger, die Markt- oder Nikolaikirche. Schon vor 1220 stand hier eine stattliche Kapelle. Rathaus und Marktkirche bezeichneten den Mittelpunkt der Stadt, bei ihnen und um sie herum wurde der Markt, auf dem der Königsfriede lag, abgehalten. Doch können wir uns kein Bild von dieser ältesten Marktkirche machen; ihre Mauern müssen aus Muschelkalk bestanden haben; ihr Baustil war romanisch. Die heutige städtische Hauptkirche wurde an derselben Stelle und unter Verwendung der alten Mauerreste zwischen 1360 und 1395 erbaut und erst 1490 noch durch eine Kapelle, die heutige Sakristei, erweitert. Die Kirche besaß 13 Altäre und 14 Vikarien. Die zweite Kirche der Stadt, St. Blasii, ist um 100 Jahre jünger als die Nikolaikirche. 1234 war auf ihrem Standort schon eine Kapelle dem heiligen Blasius geweiht, doch die jetzige Kirche stammt erst aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Sie besaß einstmals zwei gleichhohe Türme, bis der eine der Türme am 24. April 1634 zur gleichen Stunde vom Blitzstrahl getroffen wurde wie der Turm von St. Petri. Älter wiederum ist die Petrikirche. Mit ihrem Bau wurde um 1290 begonnen, so daß also das Kirchenschiff in der ersten Blütezeit deutschen Städtewesens entstanden ist. Mit dem Emporziehen des Turmes fing man 1362 an, vollendet wurde er kurz nach 1400. Die Sakristei wurde erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts angebaut. Durch verschiedene Umbauten und Erneuerungen hat das Äußere der Kirche gerade nicht gewonnen; das Langhaus stellt sich als ziemlich arges Flickwerk dar. Zu diesen drei noch heute vorhandenen Kirchen der Altstadt, abgesehen von der Domkirche und der noch unten zu erwähnenden Barfüßerkirche, kamen noch drei in den Vorstädten. Die älteste ist die schon besprochene Frauenbergkirche. Die zweite ist die Marienkirche im Tale, die Altendorfer Kirche; sie war schon 1294 vorhanden; der Propst des Kreuzstiftes war ihr Patron. Und an Stelle der dritten, der heutigen Neustadt- oder Jakobikirche, die erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut worden ist, erhob sich einst die alte Kirche für das Neue Dorf. Diese stammt schon aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts, der Turm, der bei der Abtragung der alten Kirche 1744 stehen geblieben ist, soll schon 1310 errichtet worden sein. Das Rathaus und diese Kirchen, abgesehen von der jüngeren Blasiikirche, sind sämtlich im 14. Jahrhundert erbaut worden und stehen großenteils noch heute als Zeugnisse für den frommen Sinn, die Schaffensfreude und den Wohlstand jener Zeiten. Wie groß die Tatkraft aber damals gewesen sein muß, geht daraus hervor, daß alle diese kostspieligen Bauten nicht etwa in einer behäbigen, ruhigen Zeit entstanden sind, sondern in einer Zeit voller innerer und äußerer Erschütterungen. Nie wieder ist soviel in Nordhausen gebaut worden, selbst nicht um unsere Jahrhundertwende herum, wo Deutschland reich und mächtig war und sich ganz andere Bedürfnisse zeigten als damals im Mittelalter. Zu den Kirchen kamen die Klöster und Klosterkirchen, die zwar aus den Mitteln der Orden gegründet waren, deren Bau doch aber nur mit Hilfe des mildtätigen Sinnes der Bevölkerung vorgenommen werden konnte. Schon die Altendorfer Kirche war zugleich Klosterkirche für die Zisterzienser Nonnen, die sich im Altendorfe 1294 angesiedelt hatten. Unfern davon erhob sich die große und schöne Barfüßerkirche der Franziskaner oder Barfüßermönche. Schon ums Jahr 1220 hatten sich die beiden soeben erst gegründeten Bettelmönchorden der Franziskaner und Dominikaner in Deutschland angesiedelt. Die Franziskaner tauchten in Norddeutschland 1223 zuerst in Hildesheim auf, 1225 waren sie in Magdeburg, bald darauf finden wir sie auch in Nordhausen. Danach klingt die Nachricht durchaus glaubwürdig, daß ihre erste Kapelle in Nordhausen 1234 ein Raub der Flammen geworden sei. Nach diesem Unglück bauten sie an der Barfüßer Straße in der Nähe der Stadtmauer in den siebziger Jahren des 13. Jahrhunderts eine neue Kirche, die 1278 eingeweiht wurde. Seit 1329 führte dieses Gotteshaus auch den Namen Spendekirche. Da sie einen großen und würdigen Innenraum aufwies, leisteten alljährlich am Dreikönigstage die Bürger dem neugewählten Rate die Huldigung in diesem Raume; erst später wurde diese feierliche Handlung in die Marktkirche verlegt. 1805 wurde der stolze Bau leider abgetragen. Die Dominikaner oder Predigermönche, die sonst überall zugleich mit den Franziskanern auftraten, sind in Nordhausen erst spät, erst im Jahre 1286, erschienen. Am 5. März 1287 wies ihnen der Rat einige Hofstätten an der Kuttelpforte zum Bau ihres Klosters zu. Von hier aus erwarben sie auch noch Termineihäuser in Stolberg, Sondershausen und Frankenhausen. Nachdem 1525 die Bauern das Kloster ausgeplündert hatten und die Reformation in Nordhausen eingeführt worden war, bestimmte der Rat das alte Kloster zur Lateinschule der Stadt. Außer diesen beiden Orden siedelte sich in der Neustadt noch der Bettelorden der Augustiner an. Er errichtete sein Kloster gegenüber dem südlichen Straßenausgang der Straße „Vor dem Vogel“, auf einem Platze, den ihm Nordhausen im Februar 1312 geschenkt hatte. Dafür waren die Mönche verpflichtet, jedesmal Michaelis für alle Bewohner Nordhausens eine Messe zu lesen. Heute ist von dem Kloster nur noch ein Stück der alten Klosterringmauer vorhanden. Zu diesen kirchlichen Bauten kamen im 14. Jahrhundert eine ganze Reihe stattlicher Profanbauten. Aus der Menge der strohgedeckten Lehm- und Holzhäuser der einfacheren Bürger ragten die Patrizierhäuser ansehnlich hervor durch ihre Größe, ihren meist steinernen Unterbau, ihre Vorbauten und Verzierungen. Hier möge nur zweier dieser Häuser gedacht werden: des Riesenhauses und des Hauses der Barte, des Riesenhauses, weil es bis heute den alten Namen bewahrt hat, des Bartehauses, weil es eins der wenigen altertümlichen Bauten Nordhausens ist. Das Riesenhaus steht am Holzmarkte, dem heutigen Lutherplatze. Was ihm den Namen gegeben, ist unbekannt; schon im Mittelalter zierte seine Vorderseite die überlebensgroße Statue eines Geharnischten mit einer Lanze in den Händen. Im 14. Jahrhundert gehörte das Haus dem Patriziergeschlecht der Tettenborns. 1375 waren hier bei Thilo von Tettenborn die vornehmen Geschlechter versammelt, um die Maßnahmen gegen die aufständischen Handwerker zu beraten. – Das Haus der Barte liegt in der Barfüßerstraße, Ecke Blasiistraße. Die Familie saß schon im 13. Jahrhundert in Nordhausen. Aus ihrem vornehmen Thüringer Geschlechte stammt auch Hermann Bart, der 1206 in Palästina Deutschordensmeister wurde und 1210 daselbst starb. Sein Nachfolger wurde der berühmte Hermann von Salza. In Nordhausen war das Geschlecht, wahrscheinlich vom Könige selbst, von allen Lasten befreit, was am 13. April 1290 König Rudolf bestätigte. So vornehm das Geschlecht war, so scheint es sich doch nicht an der Verwaltung der Stadt beteiligt und in keiner Verbindung mit den anderen Gefreundten gestanden zu haben. Wohl aus diesem Grunde bestritt im Jahre 1336 der Nordhäuser Rat den Bartes ihre Vorrechte und wollte sie zu den Steuern heranziehen. Noch um 1500 ist die Familie in Nordhausen nachzuweisen; damals muß sie das heute noch stehende Gebäude errichtet haben.[23] Es berührt den modernen Menschen seltsam, wieder und wieder im Mittelalter, selbst für Privatpersonen, auf dergleichen Ausnahmestellungen und Ausnahmerechte zu stoßen, wie es hier bei dem Geschlechte der Barte der Fall ist. Solche Sonderrechte schränkten die Staatsgewalt naturgemäß nicht unwesentlich ein, wurden deshalb bekämpft und doch immer wieder verliehen, weil man ja keinanderes Mittel, Verdienste zu belohnen, kannte. In Nordhausen haben wir nun schon eine ganze Reihe von Vorrechten kennengelemt, welche die Befugnisse des Rates durchkreuzten. Da waren der Vogt und der Schultheiß, die, obwohl nunmehr ihr Einfluß ausgeschaltet war, doch eine Sonderstellung einnahmen und von denen besonders der Inhaber des Schulzenamts die wichtigen indirekten Steuern des Zolls und der Münze erhob, welche der Stadt verloren gingen. Dazu kam die völlige Selbständigkeit des Kreuzstiftes, seine Aufsicht über Nordhausens Hauptkirchen und seine Besteuerung der Hofstätten in Nordhausen. Doch neben diesen wichtigsten und für die Stadt am schwersten erträglichen Exemtionen standen noch viele andere. Am wenigsten beeinträchtigte noch die Besitzung des deutschen Ordens in Nordhausen die Stadt. Der Deutschorden hatte von je her in Mitteldeutschland viele Anhänger und viel Besitz gehabt; namhafte Führer des Ordens waren Thüringer von Geburt. So war der Orden auch in Nordhausen schon vor 1300 ansässig geworden. Am 11. August 1307 schenkte ihm König Albrecht I. auf Bitten der Nordhäuser Bürger die Höfe, auf denen einst die alte, 30 Jahr vorher zerstörte Königsburg gestanden hatte. Einen dieser Höfe überließ noch im November 1307 der Komtur Gottfried von Körner der Ballei Thüringen aus Freundschaft zur Stadt einem Nordhäuser Patrizier. Zu dem Grundstück des Ordens gehörten 120 Morgen Land in Salza, die der Orden erst 1574 verkaufte. Der Ordenshof selbst muß aber schon vor 1500 aufgegeben worden sein. Übrigens besaßen die Deutschritter auch sonst noch Rechte in der Nordhäuser Flur, und zwar in dem alten Reichsdorf Niedersalza, wo ihnen das Patronatsrecht über die Kirche sowie 120 Morgen gehörten. Allerdings kamen diese Eigentumsrechte nicht dem Nordhäuser Hofe, sondern dem Deutschordenshause in Mühlhausen zu. Während die Stadt die Höfe des deutschen Ordens zu städtischen Lasten heranziehen konnte, waren andere Ordensbesitzungen in Nordhausen frei. Als in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts die Zisterzienser und Prämonstratenser ihre für Deutschland so wertvolle Kulturaufgabe begannen, legten sie ihre Klöster meist einsam auf dem Lande an, das sie urbar machen wollten, oder in wenig besiedelten Dörfern. Doch was die Mönche hier der Bevölkerung Gutes taten, vergalt diese in reichlichem Maße. Bald gediehen die einzelnen Klöster und Abteien durch die Frömmigkeit und Mildtätigkeit der umliegenden Landschaften zu außerordentlicher Wohlhabenheit. Schließlich hatten die angeseheneren Klöster, zu denen auch Walkenried zählte, in allen deutschen Gauen Ländereien, Fruchtzinsen, Geldabgaben und in den Städten als den Zentren des Verkehrs Häuser und Höfe, die als Niederlagen für die aufkommenden Jahreszinsen benutzt wurden. So besaßen auch in Nordhausen drei Klöster ihre Höfe, in die von der Umgebung die Früchte gebracht wurden: Ilfeld, Walkenried und Sittichenbach. Der Ilfelder Hof lag Ecke Pferdemarkt und „vor dem Hagen“. Hier besaßen die Klettenberger Grafen ein größeres Grundstück, mit dem zwei Nordhäuser Bürger von ihnen zu Lehen gingen. Als sie in den sechziger und siebziger Jahren ihre Güter in unserer Gegend veräußerten, schenkten sie 1277 dem Kloster Ilfeld den Hof. Doch dieser blieb nicht das einzige Anwesen der Ilfelder Mönche in Nordhausen. 1321 vermachten die Honsteiner dem Kloster noch einen Hof vor dem Hagen, und am 5. Juni 1389 schloß der Rat mit dem Kloster einen wahrscheinlich für die Mönche nicht schlechten Tausch ab, indem die Stadt dem Kloster eine weitere Hofstätte auf dem Hagen frei von Wachtdienst und Grundsteuer überließ und selbst dafür Geld- und Hühnerzinsen einhandelte, zu denen eine Reihe von Nordhäuser Bürgern dem Kloster verpflichtet war. Durch diesen Vertrag erlangte der Ilfelder Klosterhof eine Ausnahmestellung in Nordhausen. Ebensolche bevorzugte Stellung erlangte das noch bedeutendere Lagergebäude der Walkenrieder Mönche, die ja die halbe Aue an sich gebracht hatten und nach Nordhausen hin ihre Ernten abfahren ließen. Schon der erste Abt des Klosters, Heinrich I. (1127-1178), hatte einen Hof für sein Kloster in Nordhausen erworben, und die Kaiser Otto IV. und Friedrich II. hatten diesen Walkenrieder Besitz in Nordhausen vom Zoll und von Abgaben befreit; doch ist uns die Lage dieses Hofes nicht bekannt. Dann aber gelang es dem Kloster, an der Ecke der Ritter- und Waisenstraße von einem vornehmen Nordhäuser Patriziergeschlecht ein geräumiges Haus zu kaufen, und nunmehr grenzten die Mönche von Walkenried am 12. November 1293 den Nordhäusern gegenüber ihre Rechte umfassend ab. Der Rat befreite den Hof vom städtischen Wachtdienste, bekam dafür aber den Zins an anderen Häusern in Nordhausen, den bisher Walkenried besessen hatte. Ferner ward den Mönchen zugebilligt, daß alle Bewohner des Hofes innerhalb seiner Umgrenzung der städtischen Polizeigewalt nicht unterliegen sollten; dagegen sicherte sich wieder der Rat vor dem weiteren Umsichgreifen der Mönche dadurch, daß diese ohne Erlaubnis ihr Besitztum nicht erweitern durften. 1343 baute dann Abt Konrad III. für seinen Kommeister in Nordhausen und dessen Arbeitsstätte ein neues, noch stattlicheres Haus. Dieses Gebäude ist durch Feuersbrünste mehrfach zerstört worden, doch steht noch immer ein Teil seiner alten Umfassungsmauer aus Dolomitquadem, und im Innern sind noch heute zwei Tonnengewölbe erhalten. Nicht solche Vergünstigungen wie der Walkenrieder Hof besaß der kleinere des Klosters Sittichenbach. Zwar war auch er vom Wachtdienst und Geschoß befreit, doch zahlte er jährlich 4 Pfund Pfennige an die Stadt. Obgleich diese Freiheiten einzelner Bürger oder gewisser Korporationen innerhalb des Gemeinwesens unbequem genug waren, so brachten wenigstens die bevorrechteten Klosterhöfe der Stadt doch auch allerhand Vorteil und glichen dadurch ihre Vorzugsstellung wieder aus. Die Bauern, die das Getreide in die Stadt brachten, kauften bei den Kaufleuten und Handwerkern ihre Bedarfsmittel ein, so daß die Bevölkerung daraus Nutzen hatte. Ferner lockte der Umschlag der Feldfrüchte, der auf den Höfen vorgenommen wurde, fremde Händler an, und dadurch stiegen Betriebsamkeit und Verkehr in der Stadt. Viel Getreide wurde von den Nordhäuser Bürgern auch selbst gekauft und blieb in der Stadt für die Bierbrauerei. Denn dies war das einträglichste Gewerbe vergangener Zeiten. Ehe Kaffee und Tee eingeführt wurden, waren ja Mehl- und Biersuppen ein Hauptnahrungsmittel, Bier das Hauptgetränk. So war der Verbrauch an Bier schon in der Stadt selbst sehr groß; der Bedarf an Bier erhöhte sich aber noch durch eine beträchtliche Ausfuhr in die umliegenden Ortschaften, die teilweise nicht brauen durften, damit den Bürgern durch den Absatz von Bier eine Einnahmequelle verschafft würde. Ja, am 28. März 1368 verbot Kaiser Karl IV. zum Nutzen der Nordhäuser ganz allgemein den Dörfern im Umkreise von einer Meile um Nordhausen jegliches Brauen. Tatsächlich war der Wohlstand der alteingesessenen Familien wesentlich auf die Braugerechtsame gegründet. So konnte der Fruchthandel der Klosterhöfe den Nordhäusern nur angenehm sein. Lieber wäre es ihnen natürlich gewesen, wenn sie selbst genügend Getreide in ihrer Flur hätten bauen können. Die kleine Stadtflur wurde immer wieder als ein Übelstand empfunden. Dabei muß man noch bedenken, daß dem Anbau von Getreide damals viel Land durch die Hopfengärten entzogen wurde, die allenthalben in der Flur zerstreut, besonders aber bei Hohenrode und am Roßmannsbach lagen. Doch um die Haltbarkeit des Bieres zu erhöhen, konnte man den Hopfen nicht entbehren, viel weniger noch als heute, und dementsprechend war der Bedarf größer. Ferner nahmen die Weinanpflanzungen, die an allen nach Süden gerichteten Abhängen angelegt waren, den Platz für Getreideanbau fort. Kein Wunder, wenn die Nordhäuser so eifersüchtig auf den Erhalt ihrer Feldmark oder gar auf ihre Erweiterung bedacht waren. Deshalb erließen sie auch so scharfe Gesetze gegen die Entfremdung von Äckern innerhalb städtischen Gebietes, deshalb trafen sie besonders immer neue Abwehrmaßnahmen gegen den Übergang von Ländereien aus bürgerlichem in kirchlichen Besitz. Dennoch gelangten große Teile, auch städtischen Bodens, in die Hand der Kirche. Der ganze Südwestzipfel der Nordhäuser Flur, fast die ganze Gemarkung von Niederrode, gehörte dem Domstift, dem Frauenbergkloster und dem Kloster Ilfeld. Nordhäuser Bürger bebauten das Land, zinsten aber der toten Hand, so daß der Stadt wesentliche Einnahmen verloren gingen. Auch sonst war in der ganzen Stadtflur die Kirche mit Ländereien reich gesegnet, vor allem das Domstift und das Zisterzienserkloster Neuwerk am Frauenberge. Wie ausgedehnt diese in der ganzen Umgebung Nordhausens auftretenden Besitzungen waren, haben wir beim Domstift schon gesehen; für zwei weitere Nordhäuser Klöster soll hier noch der Nachweis geführt werden, nur um zu zeigen, wie ungeheuer reich die Kirche im Mittelalter mit weltlichem Gut gesegnet war. Wir nehmen das Altendorfer und das Frauenberger Nonnenkloster. Die Nonnen des Altendorfes besaßen ihr Kloster zunächst in Bischoferode bei Woffleben. Hier hatte Graf Dietrich von Honstein im Jahre 1238 13 Jungfrauen den Nicolausberg, den jetzigen Kirchberg, geschenkt. Sie brauchten davon nur eine kleine Abgabe an den Ortspfarrer zu entrichten. 1251 bestätigte Papst Innozenz IV. die Gründung, und schon ließen es sich die Grafen der Umgebung angelegen sein, das Kloster zu beschenken. Am 28. September 1262 überließ ihnen Graf Friedrich von Beichlingen 30 Morgen Land und 7 Hofstätten mit Wiesen, Wald und einem Fischteich in dem Dorfe Schate bei Steinbrücken; am 28. Januar 1268 kauften die Nonnen dem Grafen seine sämtlichen Liegenschaften in Schate ab. 1264 bedachten die Klettenberger Grafen das Kloster mit Land in Groß- und Kleinwerther. Trotz dieser Schenkungen ging es den Nonnen zunächst nicht gut. 1264 brannte ihr Kloster ab; auch wohnten sie in einer armen, damals noch völlig wilden Gegend, in locis horroris et vastae solitudinis', deshalb erhielten sie mehrfach Unterstützung von ihrem Oberhirten, dem Mainzer Erzbischof. 1271 schrieb dieser ihnen ein 40-tägiges Ablaßrecht zu, so daß ihr Kirchlein der Anziehungspunkt für viele Gläubige und Sünder wurde, die für den Ablaß ihr Scherflein stifteten, und 1281 bekamen sie Erlaubnis, in der Diözese Mainz für ihr Kloster zu sammeln. 1273 hatten sie ferner dadurch eine Erwerbung gemacht, daß sie ein Stück Wald bei Appenrode zwischen sich und dem Frauenbergkloster zu Nordhausen teilten. Doch behaglich fühlten sich die frommen Schwestern in ihrer Einöde nicht, und als gar 1294 Adolfs Kriegsscharen in bedrohliche Nähe kamen, setzten es die Honsteiner bei ihrem Verwandten, dem Dompropst Elger zu Nordhausen, durch, daß ihre Schutzbefohlenen, die Nonnen vom Niclasberg bei Bischoferode, unter die Mauern Nordhausens flüchten durften. So kamen sie ins Altendorf und in die unmittelbare Nähe des schon bestehenden Kirchleins. Die Honsteiner blieben ihre Schutzvögte, da ja ihr Kloster ursprünglich auf ihrem Grund und Boden gelegen War. Im übrigen hatte Propst Elger die Übersiedelung nicht umsonst gestattet. Das Nonnenkloster gelangte in scharfe Abhängigkeit vom Domstift, die dadurch zum Ausdruck kam, daß der Propst des Altendorfer Klosters vom Stift ernannt wurde und das Domkapitel jede Erwerbung des Klosters gutheißen mußte. Hier in der neuen Umgebung wurden nun die Nonnen bald reicher. Nicht lange nach der Verlegung gingen schon die Scherf- und die Rotleimmühle in ihren Besitz über. Der Rat focht zwar kurz vor 1300 diese Erwerbung an, doch wurde sie den Nonnen zugesprochen. Erst in Mai 1523, in der Reformationszeit, verkaufte das Kloster die Mühlen an die Stadt. Dazu gesellten sich nun aber eine Anzahl von Vermächtnissen alter Leute, die in die Beschaulichkeit traten, vom Kloster genährt und behaust zu werden, dafür aber ihren Besitz dem Kloster vermachten. Auf diese Weise erwarb das Kloster 1393 z. B. auch 10 Morgen Weinland bei Hohenrode. Viel reicher war allerdings das Frauenbergs-Kloster Neuwerk. An ihm kann man besonders studieren, wie sich die Güter eines Klosters ins Riesige ausbreiten konnten, und deshalb sollen hier einmal ganz trocken und dürr nur die Erwerbungen, die es im 13. und 14. Jahrhundert machte, aufgezählt werden. Schon bald nach seiner Gründung in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts besaß das Kloster Liegenschaften in Windehausen, Risla, Bielen, Sachswerfen, Woffleben, Mauderode, Limlingerode, Mörbach, Uthefelde, Salza und Kehmstedt. Kurz danach hatte es in den Bruderkämpfen Philipps von Schwaben und Ottos IV. mancherlei Anfechtungen zu erleiden. Hier und da wurden ihm Güter einfach entwendet, so auch von Elger, Grafen von Honstein; doch machten dessen Sohn Dietrich und sein Enkel Heinrich das Unrecht ihres Vaters wieder gut, indem sie dem Kloster 1242 75 Morgen zurückerstatteten. Von da an blieben die Honsteiner auch weiter die Beschützer und Beschenker des Klosters. Sie schenkten am 23. April 1256 die Parochie Bennungen, 1271 traten sie einen Wald, den Eichenberg, bei Petersdorf an das Kloster gegen Vergütung ab, am 21. Januar 1285 vermachten sie dem Kloster eine gewaltige Schenkung zur Abrundung seines Besitzes. Dazu gehörten 150 Morgen in Uthleben, ein Wald bei Appenrode, einige Hufen der Flur Gumprechterode, 15 Morgen auf der Hart über dem Eingang zur Windlücke, einige Hufen Hopfenland bei Rossungen am Roßmannsbach, 60 Morgen in Kleinwerther, 15 Morgen in Herreden. Dazu kamen am 10. Mai 1293 120 Morgen bei Bennungen, am 23. März 1298 30 Morgen und ein Hof in Thüringehausen, wozu zur Abrundung das Kloster im Juli desselben Jahres noch 30 Morgen kaufte, am 10. Juni 1312 90 Morgen, am 30. Mai 1351 15 Morgen, 1338 10 Morgen, sämtlich in Bielen, ebenso Wiesenland bei Berga, 1348 der Teich in Petersdorf. Alles das waren Honsteiner Schenkungen. Von anderen Grafengeschlechtern hatten dem Kloster die Klettenberger schon 1242 generell den Erwerb von Gütern gestattet, die ihnen gehörten. Am 1. April 1277 erlaubte fernerhin Albrecht, Landgraf von Thüringen, den Ankauf von Liegenschaften im Thüringer Lande. Um die Fülle der Erwerbungen zeitlich weiter zu verfolgen, seien sie angeführt: 1251 wurden Güter in Rodeleben geschenkt, 1267 vermachten Mathilde von Anhalt und ihr Sohn Otto 75 Morgen in Ebersbom bei Urbach, 1274 wurden 60 Morgen in Heringen gekauft, ebenso 1275 90 Morgen in Obersalza, dem heutigen Salza. Am 24. Februar 1283 gingen 105 Morgen in Thüringehausen in den klösterlichen Besitz über, am 12. Januar 1285 wurden 60 Morgen von Albert von Ebeleben zum Seelenheil seiner Mutter geschenkt. 1307 wurden 115 Morgen in Talebra, 1308 45 Morgen in Kleinwerther, 1318 mehrere Hufen in Niederrode und Ritterode bei Werther erworben. 1323 bekam das Kloster 30 Morgen und einen Hof in Trebra, 1328 zwei Höfe in Uthleben, 1329 45 Morgen in Grona, 1331 vermachte Friedrich von Heldrungen ein Grundstück und einige Morgen in Kleinwerther. 1337 wurden 60 Morgen bei Oberspier gekauft, ebenso 1347 7 1/2 Morgen in Görsbach, 1350 37 1/2 Morgen in Rockstedt, 1367 30 Morgen in Berga, 1375 5 Morgen Wiesen bei Berga. Von den Erwerbungen in der weiteren Umgebung Nordhausens seien noch genannt: 1280 150 Morgen und 4 Höfe in Bückersleben, 1286 60 Morgen in Bellstedt, 1290 in Rockersleben, 1291 wieder 15 und 1309 37 Morgen in Bellstedt. Dazu kamen die Güter, welche die Novizen, die in das Kloster eintraten, demselben vermachten. So wurde am 22. November 1306 vertraglich festgelegt, daß 90 Morgen in Bielen als Ausstattung einer Nonne gelten sollten, die nach deren Tode ans Kloster fielen; ebenso gingen am 28. September 1330 80 Morgen bei Schernberg in den Besitz des Klosters über. Am 1. Mai 1374 trat eine Tochter der angesehenen Nordhäuser Familie Weißensee ins Kloster ein, die einen Zins von 1 Mk. Nordhäuser Pfennige und 14 Hühner jährlich von mehreren Anwesen in Nordhausen mitbrachte. Auch diesem Kloster wurde ferner, um Interesse für dasselbe zu erwecken, Ablaß erteilt. So gestatteten am 2. Mai 1338 vier Kardinäle dem Kloster einen zwanzigtägigen Ablaß.[24] Wenn so reiche Klöster in der späteren Zeit des 15. Jahrhunderts gezwungen wurden, Kapitalien aufzunehmen, so ist das ein Zeichen dafür, daß die Freudigkeit im Geben allmählich nachließ und daß der Wert des Bodens in der Zeit der erstarkten Geldwirtschaft sank; wenn dagegen am 5. Juni 1364 das Frauenbergskloster die gewaltige Summe von 100 Mk. Silber zu 5 Prozent aufnahm, so geht daraus nur hervor, daß es mit diesem Gelde Geschäfte machen wollte.Ein Kloster von diesem Besitzstände empfand natürlich auch die Abhängigkeit vom Domstift drückend und versuchte sie abzuschütteln. Zum Konflikt kam es, als der schon mehrfach erwähnte Propst Elger von Honstein im Jahre 1296, ohne die Nonnen zu fragen, ihnen einen Propst ernannte. Da ließen es die Nonnen auf eine Kraftprobe ankommen und wählten sich selber den Magister Dietrich, Pfarrer an St. Blasii, zum Propst. So kam es zum Streit, der schließlich vor einem Forum von sechs Geistlichen geschlichtet wurde. Das Recht des Klosters wurde erweitert, die Nonnen behielten die freie Propstwahl, nur das Aufsichtsrecht des Domstifts blieb bestehen. Als äußeres Zeichen der Abhängigkeit mußten die Geistlichen des Klosters an den Prozessionen des Domkapitels teilnehmen. Nordhausen selbst hatte im 13. Jahrhundert noch kein Arg, wenn seine Bürger der Kirche Schenkungen vermachten. 1242 ging ein Hof in Nordhausen an das Frauenbergkloster über, und 1246 erwarb es beim Hause des Bürgers Konrad Silberbalt zwei Tuchrähmenplätze. Dann aber leistete die Bürgerschaft nach und nach Widerstand. Man befürchtete, die Hoffnung der Bürger, durch fromme Schenkungen sich einen Schatz im Jenseits zu erwerben, könnte die Schätze im Diesseits doch gar zu sehr vermindern. So fiel seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts kein eigentlich Nordhäuser Besitz mehr an die Kirche. Zu Auseinandersetzungen über den gegenseitigen Besitzstand kam es zwischen Stadt und Kloster nur mehrfach, wenn die Stadt Sicherheitsanlagen schaffen wollte. 1299 mußte der Rat deshalb beim Wehr der Klostermühle einen Platz erwerben, und auch noch im 14. Jahrhundert, z. B. 1355 und 1360, feilschte das Kloster mit der Stadt um Gelände zur Anlage von Befestigungen. Solche Auseinandersetzungen mit der Kirche bereiteten der Stadt Nordhausen nicht geringe Schwierigkeiten, und die ernstliche Sorge, welche bei dergleichen Verhandlungen nicht selten die berufenen Vertreter der Stadt ergriff, mochte sich in Haß verwandeln, wenn man auf den Reichtum der Kirche in der Nordhäuser Feldflur und rings im Lande blickte, mochte gar zu blinden Wutausbrüchen führen, wenn man durch das hoffärtige Wesen mancher Geistlichen gekränkt war. Das Verhältnis der Bürger zur Geistlichkeit sollte nun zum ersten Male auch die Spannungen aufdecken, die, innerhalb der Bürgerschaft selbst, schon in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts vorhanden waren. Es ist nicht leicht, die verschiedenartigsten seelischen Schwingungen der Menschen jener Zeit bloßzulegen; außerordentlich mannigfaltig waren die Strebungen und Gefühlseinstellungen, die durcheinandergingen. Die herrschende Klasse in Nordhausen, die Patrizier, waren mit der Geistlichkeit darin einig, daß das Bestehende möglichst erhalten bleiben müßte. Dennoch sahen gerade die Gewalthaber der Stadt die Vorrechte und den Reichtum der Kirche als eine Kränkung und Beschneidung ihrer eigenen Rechte an. Ferner: Auf der einen Seite sicherte der Bestand der augenblicklichen Verhältnisse Patriziern wie Klerikern ihre Vormachtstellung. Und wieviel kleiner, aber doch hochgeschätzter Hausrat hing nicht auch weiterhin damit zusammen! Lebens- und Umgangsformen, gesellige Haltung und Bildung verknüpften die alten Geschlechter und die Geistlichen fast unlöslich. Auf der anderen Seite wühlte doch auch wieder bei jenen tatenfrohen Menschen die Mißachtung vor den weichen, untätigen, ihnen geistig doch häufig überlegenen Priestern alle bösen Triebe auf.




Und dazwischen standen, ohne vermitteln zu können, die vornehmen Geschlechter. Ihrem ganzen Herkommen nach fühlten sie sich der Geistlichkeit verpflichtet, als selbstbewußte Bürger aber dachten sie wie das Volk. Auf der einen Seite lockte das tief im Blute sitzende Standesgefühl, auf der anderen Seite zog das jüngere und verstandesmäßigere Staatsgefühl. Interessant aber ist es, daß da, wo um 1320 zum ersten Mal ein Gegensatz zwischen Patriziern und Plebejern schärfer hervortritt, der Kampf um die Erziehung und Bildung der Jugend ging. Dieser Wunsch des Volkes zu Nordhausen nach einer eigenen Schule ihres Geistes fiel mit den Tendenzen der Zeit durchaus zusammen. In der ganzen westeuropäischen Welt wurde damals zum ersten Male die Frage aufgeworfen, ob es Pflicht und Recht des Staates oder der Kirche sei, die heranwachsende Jugend zu bilden, ob es Aufgabe der Schule sei, die Jugend im Sinne des Staates oder nach den Idealen der Kirche zu formen, ob der Mensch für das Diesseits und das laborare oder für das Jenseits und das orare vorbereitet werden solle. Zum ersten Male tauchte in der christlich-katholischen Welt der Gedanke vom Eigenwert der Welt empor, vom Eigenwert der civitas terrena gegenüber dem bisher allein anerkannten der civitas coelestis. Das war eine Bewegung, die zum Protestantismus hinführen mußte. Worum es damals im kleinen Nordhausen ging, darum ging es auch in der großen Welt. Zu derselben Zeit stand König Ludwig der Baier im Kampf mit dem Papsttum. Auf Seiten des Königs standen das Volk und von der Geistlichkeit diejenigen, welche im Volke wurzelten, die Minderbrüder und Bettelmönche; auf Seiten des Papstes stand die hohe Geistlichkeit. Zu derselben Zeit war es auch, wo es zum ersten Male der Berater des Königs, Marsilius von Padua, in seinem Defensor pacis wagte, von einer Souveränität des Volkes zu sprechen, wagte zu behaupten, daß alle menschlichen Einrichtungen zum Wohle des Volkes daseien, also auch die Kirche, also auch die Schule. Demokratie und Diesseitigkeit gegen Aristokratie und Jenseitigkeit! Das war das Entscheidende auch für Nordhausen. In dem nach außen sichtbaren Begehren nach einer eigenen Schule äußerte sich das unsichtbare und noch unbewußte Verlangen nach einem Eigenleben überhaupt. Auch die große Menge begann allmählich zu erwachen und nach Lebensformen zu suchen, die ihr penüge taten. Zunächst freilich schienen überall nur Widersprüche und Unzulänglichkeiten sichtbar. Hier hohe Geistlichkeit und Gefreundte, dort Kleinbürger; hier Landadel und Stadtadel, dort Bauern und Bürger; hier Freude am Angriff und Kampf und an allem Hasardspiel des Lebens, dort Wunsch nach Beschaulichkeit und Frieden und dem Glück im Winkel. Der andere Lebensrhythmus war es, der die verschiedenen Stände mit Naturnotwendigkeit gegeneinander trieb. Und doch auch wieder diese staatliche Verbundenheit auf Tod und Leben zwischen allem, was damals Bürger hieß in Nordhausen, ob vornehm, ob gering. Auch hier waren tiefe Instinkte vorhanden, die dahin drängten, die städtischen Belange gegen jedes Sonderrecht zu verteidigen. Es war der Bürgerstolz, der in allen Einwohnern der Stadt lebte und sie gegen alle Feinde der Stadt zusammenführte. Er lebte wohl in allen, aber nicht in gleicher Weise, weil eben Abstammung und Charakter und Lebensart ganz verschieden waren. So hatte man seit noch nicht langer Zeit ein Bündnis mit Erfurt und Mühlhausen geschlossen. Das war allen Bürgern recht; doch den einen, weil sie nun durch die größere Stoßkraft Macht und Ehre gewinnen konnten, den anderen, weil sie sich nun in größerer Sicherheit vor Gefahren glaubten. Der Kleinbürger hätte am liebsten gesehen, wenn die Erfurter und Mühlhäuser mit auf die Nordhäuser Mauern geklettert wären zu ihrem Schutze; da aber nicht sie, sondern die Gefreundten das Heft in der Hand hatten, führte das Bündnis zu einem langwierigen Zuge in thüringisches Land hinein zum Verdruß des kleinen Mannes. tzen, Naturnotwendigkeiten und Widersprüchen gegenüber. Am tiefsten war damals aber doch der Gegensatz zwischen Geistlichen und Laien. Die großen Ländereien nicht nur heimischer, sondern auch auswärtiger Stifter in der Stadtflur, die Freiheit von den städtischen Lasten, die Abhängigkeit vieler Bürger von der Kirche wirkten demütigend und aufreizend. Dazu kam eine allmählich unerträgliche Anmaßung der Kirche auch in weltlichen Dingen, die sich besonders in der Handhabung der geistlichen Gerichtsbarkeit zeigte. Denn die Kirche zog nicht nur Streitigkeiten zwischen Geistlichen und Laien vor ihr geistliches Gericht, sondern auch rein zivilrechtliche Angelegenheiten, wie das Zinsennehmen, Erbanfälle und dergleichen mehr. Schließlich kam der Unwille zum Ausbruch. Am 27. Juni 1319 gestattete Papst Johann XXII. den Bürgern auf ihre Bitten, eine Schule bei einer der Stadtkirchen zu errichten. Dafür war die Petrikirche in Aussicht genommen. Zwei Gründe hatten die Bürger für ihr Vorhaben angegeben: Die Stadt sei größer geworden, so daß manche Knaben die Schule des Kreuzstiftes wegen der Entfernung nicht besuchen könnten, und die Zahl der eingeschulten Kinder sei so angewachsen, daß ein Schulmeister für den Unterricht nicht mehr genüge. Diesen Erlaß hatte die Bürgerschaft hinter dem Rücken der geistlichen Herren vom Papste erlangt. Er schien erschlichen zu sein, und so begann der offene Kampf. Hier stand das Domkapitel und der größere Teil der Gefreundten, dort standen einige andere Geistliche und besonders Minderbrüder, dazu die große Masse des Volkes und einige wenige Gefreundte. Noch stand man sich Gewehr bei Fuß entgegen. Doch dann kam 1321 der Heereszug der Stadt gen Thüringen, wider den die Kleinbürger murrten, und dann kamen die verhängnisvollen Entscheidungen des Königs vom Jahre 1323. Am 1. Mai 1323 befreite Ludwig der Baier Nordhausen von der geistlichen Gerichtsbarkeit, ein großer Erfolg der Bürger, eine große Niederlage der Kirche! Doch gleich darauf säte der König durch einen zweiten Erlaß Unzufriedenheit und Haß in die Gemüter der Nordhäuser. Am 7. Mai 1323 verpfändete er Nordhausen und Mühlhausen für 10000 M Silber an seinen Schwiegersohn Friedrich von Meißen. Das mußte der Stadt gewaltige Opfer auferlegen; und wenn auch die Gefreundten schuldlos waren an den neuen Steuern, so wurden diese von dem einfachen Mann doch in Zusammenhang mit den Unternehmungen der Geschlechter gebracht, und der Groll wuchs an. Riesengroß aber ward die Erregung, als der König noch in demselben Jahre am 2. August das wichtige Schultheißenamt den verhaßten Honsteinem verlieh. Auch hier traf niemanden eine Schuld, doch der alte Gegensatz zwischen Stadt und Land tat sich auf. Und die Geschlechter hielten es mit dem Lande; das war gewiß. Das Maß war voll; 1324 kam es zu offenem Aufruhr. Jahrelang hatte die Masse, der Herr omnes, wie sie bezeichnend in einer Quelle heißt, gegrollt, doch nichts getan. Denn die Masse will einen Anführer haben, der ihr Halt und Richtung gibt; eher wagt sie nichts. Jetzt hatte sie einen Führer in Heinz von Wechsungen. Natürlich war es einer aus vornehmem Geschlecht. Das ist zu allen Zeiten so. Aus der Aristokratie entwickelt sich die Demokratie dann, wenn ein Aristokrat, von dem Ehrgeiz gepackt, allein zu regieren, seine Standesgenossen verläßt, sich an die Spitze des Herrn omnes stellt und sich mit dessen Hilfe zum Alleinherrscher – Tyrann, sagen die Griechen – aufzuwerfen sucht. Das Haus des Bürgermeisters Thilo ward gestürmt, eine Anzahl Ratsherren wurden aus der Stadt vertrieben. Der Kleinbürger herrschte in der Stadt oder vielmehr Heinz von Wechsungen, den man auf den Schild erhoben. Doch die Vertriebenen blieben nicht untätig und wühlten und hetzten draußen auf dem Lande gegen die Stadt. Erfurt, Mühlhausen und Greußen versuchten eine Schlichtung aus ehrlichem, bürgerlichem Solidaritätsgefühl. Es fruchtete nichts. Der König griff ein und befahl die Aufnahme der Verstoßenen. Es fruchtete nichts. Jetzt verquickten die Domherrn die Staatsumwälzung mit dem Streit um die Schule und ergriffen Partei für die vertriebenen Geschlechter. Da wurden alle Hemmungen mißachtet; der Sturm brach los. Der Pöbel drang in die Häuser und Höfe der Domherren, mißhandelte, vertrieb sie, verwüstete, riß nieder. Schließlich erregte jeder Besitz die Wut des Volkes. Vom Domstift aus ging es vor die Judenschule. Da saßen die Peiniger des Volkes ebenso wie im reichen Kapitelsaal. So ward auch die Synagoge geplündert, die Juden wurden mißhandelt, und fortgetragen ward alles, „was sie seit langer Zeit zusammengescharrt“. So revolutionierte das Volk gegen alle Welt, gegen König und Herrn draußen, gegen Geistliche und Besitzende drinnen. Nun aber griffen die großen Herren ein und machten die Sache der Vertriebenen zu der ihren. Die Honsteiner Grafen und sogar die Braunschweiger Herzöge begannen sich zu regen. Sie gedachten ganz allgemein gegen die aufsässige Stadt ini Trüben zu fischen; doch der Honsteiner wußte auch, daß der Aufstand gegen ihn als Besitzer des Schulzenamtes ging. Da wurden die Straßen gesperrt, die Zufuhren abgeschnitten, die Felder verheert. An die Seite der weltlichen Herrn trat der Mainzer Erzbischof und nahm sich des Domstifts an. Er ernannte eine Kommission zur Untersuchung des Streites, der die Domherrn Hermann von Bibra und Siegfried von Halle sowie der Pfarrer Dietrich von Mildenstein zu Erfurt angehörten. Die Verhandlungen sollten in Erfurt stattfinden, ein unmögliches Verlangen, da vor den Toren Nordhausens die Honsteiner samt den Vertriebenen lauerten, um die Unterhändler abzufangen. Deshalb baten die Nordhäuser um Untersuchung in Nordhausen selbst. Der Mainzer ging scheinbar darauf ein, wünschte nun aber seinerseits sicheres Geleit für die Kommission. Dies glaubten wieder die Nordhäuser nicht gewähren zu können, da sie außerhalb ihrer Mauern selbst in Gefahr waren, innerhalb der Stadt aber der Pöbel drohte. Es scheint so, als ob beide Teile Schwierigkeiten machten: Die Geistlichen wollten Nordhausen von vornherein ins Unrecht setzen, und die Nordhäuser trauten der Kommission keinen fachlichen Schiedsspruch zu. Die Zuflucht der Bürger war wieder der Papst. Doch ehe sie noch zu dieser letzten Hilfe griffen, hatte der Erzbischof sie schon exkommuniziert. Nun übertrug der Papst auf das Hilfegesuch der Nordhäuser hin am 22. November 1325 die Untersuchung und Entscheidung den Äbten von Walkenried, Volkerode und Seligenstadt, und als er von dem Bannstrahl des Mainzer hörte, befahl er am 15. Dezember beschleunigte Verhandlungen. Die drei Äbte versuchten zwar im Februar 1326 die Sache zu klären, konnten sich aber der Mainzer Kommission gegenüber nicht durchsetzen. Das Eingreifen des Papstes hatte jedoch unzweifelhaft schon eine Wendung zum Bessern für Nordhausen herbeigeführt. Da verdarb der Wankelmut des niederen Volkes alles. Statt auszuharren und abzuwarten, wie die Auseinandersetzungen der beiden Kommissionen endigen würden, und statt aus diesem Kompetenzstreit Vorteile zu ziehen, gab die Masse unter dem Druck der augenblicklichen Not nach. Der Streit mit den Honsteinem wegen des Schulzenamtes tobte 1325 heftiger denn je; die über die Stadt verhängte Sperre war lückenlos; Hungersnot drohte. So vergaß die Menge des Volkes über dem Augenblick die Vergangenheit und die Zukunft und verlangte den Frieden um jeden Preis. Zwar taten ihre Führer alles, um den Mut zu heben und den Widerstand neu zu entfachen: Es gelang ihnen, Boten nach Erfurt zu senden, welche dort um Vermittlung nachsuchen sollten; sie riefen das Thüringische Landfriedensgericht an. Alles war umsonst. Ohne weitere Schritte abzuwarten, forderte die Menge sofortige Abstellung ihrer Not. Das Volk vergaß, daß es selbst ja den Aufruhr gewollt und angezettelt hatte; es suchte nach einem Schuldigen, und gegen einen satten Magen nahm es gern die schwersten Demütigungen auf sich. So mußte denn Heinz von Wechsungen dran glauben; sein Traum, an der Spitze des Volkes in Nordhausen Diktator spielen zu können, war ausgeträumt. Er mußte zwei Jahre ins Gefängnis wandern, 150 M lötiges Silber – d. h. 150 Pfund reinen Silbers – und 4 M Nordhäuser Silber – d. h. 4 Pfund dem Nennwerte nach – bezahlen. Vier weiteren Gefreundten ging es ähnlich; gerade ihre Verhandlungen mit Erfurt wurden ihnen zum Vorwurf gemacht. Nachdem man so Selbstmord verübt hatte, blieb nichts weiter als Unterwerfung übrig. Im Frühjahr begannen in Erfurt die Verhandlungen mit der Mainzer Kommission, und zwar unter völliger Ausschaltung der päpstlichen. Sie kamen zum Abschluß am 24. Juni 1326 durch einen Spruch der drei Richter, der außerordentlich geringes Verständnis für die Wünsche der Bürger zeigte. Nordhausen erlangte nur, daß der über die Stadt verhängte Bann aufgehoben wurde und die gegenseitigen Übergriffe vergessen sein sollten. Im übrigen setzte der Schiedsspruch Nordhausen überall ins Unrecht. Die Schule auf dem Petersberg wurde verboten und die Domschule alleine anerkannt. Nur den weit entfernt wohnenden Schülern war ein Fehlen bei der Frühmesse gestattet. Außerhalb der Stadt durften die Bürger eine Schule anlegen; jedoch, so hieß es, sollten die Schüler dieser Bürgerschule die Domschüler „nicht betrüben“, sonst sollte ihr Schulmeister sie züchtigen. Bald darauf entstand auch eine Schule in der Neustadt bei der Jakobikirche, und diese gemeinsame Schule trug später mit dazu bei, daß dieser neue Stadtteil seine Vereinigung mit der Altstadt fand.[25] Doch die Niederlage der Bürger wird auch dadurch als vollständig gekennzeichnet, daß alle Beschlüsse der Bürger, die gegen die „geistlichen Freiheiten“ gefaßt waren, aufgehoben wurden. Die Häuser der Domkapitulare behielten ihre Steuerfreiheit und standen weiterhin nicht unter Nordhäuser Gerichtsbarkeit, auch wenn sie an Fremde vermietet waren. Auch Braugerechtsame durfte das Kapitel ausüben und dadurch den Bürgern Konkurrenz machen; ja, der städtische Bierschröter war verpflichtet, dem Stifte Hilfe zu leisten. Dem bürgerlichen Gerichte stand nicht zu, Geistliche zu pfänden oder sonst über ihre Habe zu verfügen. Schließlich mußten die zerstörten Stiftshäuser auf Kosten der Stadt so schnell wie möglich wieder aufgebaut und das geraubte Gut binnen einem Monat zurückgegeben werden. Zu diesen Bestimmungen, die große Opfer verursachten und die jahrelange planvolle Erweiterung städtischer Rechte unterbanden, traten weitere, die Stadt tief demütigende. Den Geistlichen, die es mit dem Volke gehalten hatten, wurde auferlegt, nach Rom zu pilgern und daselbst Gnade zu erlangen. Ihrer Pfründen gingen sie für immer verlustig. Die Nordhäuser Ratmannen mußten den vertriebenen Geistlichen bei ihrem Einzug entgegenreiten, ihnen vor den Toren mitteilen, daß aller Zwist beigelegt sei, und sie danach in festlichem Zuge einholen. Die Kommission hatte weiterhin das Gehen vor dem Kreuze, das Tragen von Kerzen, die Stiftung von Altären zur „geistlichen Besserung“ bestimmt; doch diese letzten Demütigungen wurden den stolzen Ratmannen auf Fürsprache des Erfurter Rates schließlich erlassen. So wurden dann im Sommer 1326 die vertriebenen Geistlichen am Sundhäuser Tore erwartet und mit großem Gepränge begrüßt. Der Festzug, in welchem Kreuze und Fahnen mitgeführt wurden, ging durch die ganze Stadt, und stolz und höhnisch genug mögen die Stiftsherrn und die Pröpste vom Neuen- und Altendorfe, die besonders scharfe Gegner der Stadt gewesen waren, einhergeschritten sein.Diesen Vergleich, d. h. die Unterwerfung Nordhausens, bestätigte Erzbischof Mathias von Mainz am 16. Juli 1326 und hob, „der Reuigen sich erbarmend“, Suspension, Exkommunikation und Interdikt auf. Dafür durfte die Stadt ihm 600 M Silber zahlen, und da das Volk der Meinung war, es habe genug getan, auferlegte es die Bezahlung dieser Summe den vornehmen „Anstiftern?. Diese sträubten sich zunächst, übernahmen dann schließlich aber doch die Bezahlung. Eine Reihe von Sühnungen aus den Jahren 1326 und 1327 zeigen die Aussöhnung unter den Bürgern. Hermann von Urbach, Konrad Tockenfuß und Sohn, Syfert Walpurge verzichteten auf Schadenersatz und gelobten, in Frieden mit den übrigen Bürgern zu leben. Tiefe Wunden und tiefe Mißstimmung hatte der Streit in der Bürgerschaft aber doch zurückgelassen. 60 Bürger blieben verbannt, gingen an den Hof der Grafen von Honstein-Sondershausen und zettelten dort Umtriebe gegen ihre Heimatstadt an. Keinem war das aber lieber als den Grafen und Herren draußen, die, durch die Entwicklung der Wirtschaft selbst in eine z. T. schwierige Lage geraten, keine Gelegenheit ungenützt ließen, ihr Schäflein auf Kosten der Städter in Sicherheit zu bringen. – Wenn man die vielfachen Wirren und Fehden des 14. Jahrhunderts verstehen will, so muß man die politischen Verhältnisse, unter denen die Deutschen damals lebten, ganz allgemein ins Auge fassen. Die Macht des Königs war seit dem Interregnum gering, die der Fürsten noch nicht stark genug. Die Landfrieden, die von Zeit zu Zeit verkündet wurden, waren in bester Absicht geschlossen, bändigten die Selbstsucht einzelner aber nicht, weil keine reale Macht hinter ihnen stand. So löste sich eigentlich alles auf in Interessengruppen: Hier bildete sich ein Fürstenbund, der auf Kosten eines anderen seine politischen Grenzen hinausschieben wollte, wie der gefährliche Bund gegen den Brandenburger Waldemar den Großen vom Jahre 1316, dort bildeten sich ständische Vereinigungen, die ihre wirtschaftlichen Interessen den anderen Ständen gegenüber durchzusetzen strebten, wie die Hanse im Norden oder der rheinisch-westfälische Städtebund im Westen, und dort wieder schlossen sich in einzelnen kleinen Landschaften Ritter oder Bürger zusammen, die wenigstens innerhalb des kleinen Gebietes ihre Belange wahren wollten, wie etwa der Bund der Ritter in Schwaben oder der Städtebund in der Wetterau. Auch in unserer Gegend bildeten sich solche Vereinigungen zur Durchsetzung irgendwelcher Forderungen. Die Grafen und Ritter des nördlichen Thüringen, die Honsteiner, Sondershäuser, Stolberger, Beichlinger, Querfurter finden wir nicht selten bei gemeinsamem Handeln. Doch waren diese Ritterbünde hier immer nur für den einzelnen Fall geschlossen, lösten sich alsbald wieder auf, und die bisher Verbündeten gingen neue Verpflichtungen ein. Deshalb waren diese Zusammenschlüsse wirklich gefährlich auch nur, wenn ihnen eine stärkere Macht, etwa Thüringen oder Braunschweig, Rückhalt verlieh. Anders war es mit dem Bündnis der drei thüringischen Städte Erfurt, Mühlhausen und Nordhausen. Das war nicht nur für den Augenblick geschlossen, sondern war gedacht und auch wirksam als dauernde Interessengemeinschaft der drei Städte. Es wurde im Jahre 1306 zum ersten Male geschlossen, nach drei Jahren, also 1309, erneut und hat dann gehalten und sich bewährt zwei Jahrhunderte hindurch. Die drei Städte waren natürlich das Bündnis eingegangen, um sich gegenseitig zu schützen gegen die Übergriffe geistlicher oder weltlicher Fürsten, gegen die Fehdelust der Grafen, gegen die Raublust der kleinen Adligen. Für Nordhausen kam dabei immer wieder das Geschlecht der Honsteiner in Frage; ein Glück für die kleine Stadt, daß diese mächtige Familie sich durch Teilungen dauernd selbst geschwächt hatte. Kurz vor dem Jahre 1201 hatte sich zunächst, aus den Honsteinem hervorgehend, die Grafschaft Stolberg dadurch gebildet, daß Heinrich von Honstein, der Bruder jenes vielgenannten Propstes Dietrich, ein kleines Gebiet an den aus dem Harze kommenden Flüßchen Thyra und Krummschlacht übernahm. Es hatten sich nunmehr also zwei Herrschaften gebildet, die honsteinsche Stammgrafenschaft im Westen und die stolbergsche im Osten. Die beiden Häuser waren verschwägert und blieben in freundnachbarlichem Verhältnis zueinander. Hundert Jahre später, im Jahre 1312 nahm die westliche Linie, das eigentliche Haus Honstein, abermals eine Teilung vor, indem es die große, reiche Grafschaft in ein Herrschaftsgebiet nördlich und eins südlich der Wipper zerlegte, die nördliche Linie erhielt Honstein, Klettenberg, Heringen, Vockstedt und die Hälfte der Grafschaft Roßla, die südliche Sondershausen, Kirchberg, Ehrich, Greußen, Klingen und die Reichsvogtei über Nordhausen. Diese südliche starb aber schon 1356 mit Graf Heinrich V. aus, und es erbten seine Schwiegersöhne, die Grafen von Schwarzburg-Arnstadt. Nur die Gebiete und Rechte, welche die Grafschaft noch nördlich der Wipper besaß, wie die Reichsvogtei über Nordhausen, gingen an die nördliche Linie Honstein-Klettenberg über. Diese nördliche Linie schwächte sich endlich am 7. November 1372 nochmals dadurch, daß Heinrich VII. als Begründer der älteren Linie Klettenberg, Lohra, Scharzfeld, eine Hälfte von Benneckenstein und die Vogtei über Nordhausen übernahm und Ulrich und Dietrich als Begründer der jüngeren Linie Honstein Heringen, Kelbra, Questenburg, Vockstedt, Morungen und den anderen Teil von Benneckenstein erhielten. Die Grenze zwischen diesen beiden Grafschaften, die für Nordhausen von besonderer Bedeutung waren, verlief gerade westlich Nordhausen, nämlich von der Dietfurt südlich Niedersachswerfen auf der Landstraße nach dem Altentor, dann an der Zorge entlang nach dem Siechhof vor Nordhausen und von da auf die Rodebrücke an der Helme zu. Die Darlegung dieser Herrschaftsverhältnisse vor den Toren Nordhausens ist nötig, wenn man die Abhängigkeiten der Stadt von den Territorialherren und ihre Auseinandersetzungen mit ihnen verstehen will. In jener ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts standen nun die Dinge meist so, daß die einzelnen aus der Linie Honstein hervorgegangen gräflichen Häuser unter sich und mit dem einen oder anderen benachbarten Geschlecht verbunden waren. Häufig standen die Grafen von Beichlingen, die an der unteren Unstrut und am Kyffhäuser Besitzungen hatten, an ihrer Seite, doch auch die Grafen nördlich des Harzes, die Blankenburger und Regensteiner, unterstützten sie wohl bei ihren Unternehmungen. Für Nordhausen am bedeutsamsten war die Stellungnahme der beiden Linien Honstein, der nördlichen, die für 20 Jahre das Schulzenamt innehatte, und der südlichen, sondershäusischen, die 1312-1356 im Besitze der Vogtei war. Wegen der Ansprüche, welche diese Linien auf Nordhausen hatten, gestaltete sich das Verhältnis zu ihnen auch am unerquicklichsten. Den größten Haß auf die Stadt hatte Honstein-Sondershausen; doch auch mit Honstein-Klettenberg gedieh der Stadt mancher Span. Friedfertig war im allgemeinen Stolberg, doch fühlte es sich den übrigen Grafschaften verbunden und stand deshalb des öfteren an der Seite der Honsteiner. Die Beichlinger und Regensteiner aber traten jedesmal dann auf, wenn es irgendeine Beute zu erhaschen gab. Ihre Politik Nordhausen gegenüber war nicht durch größere Gesichtspunkte bestimmt, sondern nur der Ausfluß einer aus Fehdelust und Adelsgroll hervorgegangenen Gefühlseinstellung.  Die kleinen Plänkeleien und Reibereien der Grafen mit der Stadt haben nun aber nicht selten als Hintergrund die größeren Auseinandersetzungen zwischen dem Reich und den Fürsten. Die ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts waren ja für Thüringen ganz besonders mit Unruhe erfüllt, weil die Nachfolger Adolfs insofern seine Politik fortsetzten, als sie genau so wie dieser Ansprüche auf Meißen und Thüringen erhoben, aber die Söhne Albrechts des Entarteten, Friedrich und Diezmann, die Länder tapfer verteidigten. So kam es auch noch während der Regierung Albrechts I. und Heinrichs VII. zu blutigen Kämpfen, bis dann Ludwig der Baier einen anderen Weg einschlug: Er stellte dem Besitzer Thüringens eine seiner Töchter zur Verfügung und zog wenigstens durch diese Versorgung Nutzen aus dem umstrittenen Lande. Nordhausen war ja eng mit dem Schicksal Thüringens verknüpft, umso enger, als am 4. Oktober 1294 Adolf von Nassau die Reichsstadt für 2000 M an Albrecht den Entarteten verpfändet hatte. Die Stadt wehrte sich zwar dagegen, die Pfandschaft durch Übernahme der Geldsumme abzulösen; was konnte sie aber schließlich tun! Sie konnte wohl, wenn König und Landesfürst entzweit waren, zu ihrem Vorteil auf der Seite des Königs gegen Thüringen Stellung nehmen oder umgekehrt. Hier waren sie aber im Bunde miteinander, und wohl oder übel mußte sie zahlen, wenn sie eine reichsfreie Stadt bleiben und nicht in den Besitz Thüringens übergehen wollte. Nach langem Sträuben übernahm sie die vom Könige eingegangene Verpflichtung, belastete gehörig die in der Stadt sitzenden Juden und bezahlte Albrecht in den ersten Monaten des Jahres 1305 die Restsumme. Am 7. März 1305 bezeugte dieser auf der Wartburg, daß die Stadt ihn befriedigt habe. Doch bei diesen, nicht für das Gedeihen der Stadt, sondern zu ihrem Schaden verausgabten Summen sollte es nicht bleiben. Nachdem die Stadt 1305 wieder völlig unabhängig geworden war, hielt sie auch zu dem, dem sie gehörte, zum Könige. Sie mußte also gegen Friedrich und Diezmann von Thüringen, die ja ihr Land gegen den König zu verteidigen hatten, Stellung nehmen. Und in diese Kämpfe wurde sie umsomehr verwickelt, als sie 1306 zum ersten Male mit Erfurt und Mühlhausen ein Schutz- und Trutzbündnis eingegangen war. Es handelte sich dabei für Nordhausen und Mühlhausen darum, daß der König ihre Reichsfreiheit verbürgte, die Fürsten sie bedrohten; für Erfurt, das die treibende Kraft bei dem Bunde gewesen war, handelte es sich um mehr: Es war keine Freie Reichsstadt, sondern eine Landstadt, desto abhängiger also, wenn der Landesfürst zu mächtig wurde, und deshalb bestrebt, die Fürstenmacht zu bekämpfen. Dazu kam bei allen drei Städten, daß auf Seiten von Friedrich und Diezmann die thüringischen Adligen, die geschworenen Feinde der Städte, standen. Deshalb blieb den drei Städten bei diesen Kämpfen um Thüringen gar nichts weiter übrig, als treu zu König und Reich zu stehen und sich gegenseitig zu helfen. Reichlich zu leiden hatten sie allerdings dabei, und ein Glück für sie war es, daß es genug verarmte kleine Adlige gab, die gezwungen waren, um Gold bei den Städten zu dienen. Manch ein Ritter, den früher sein Gutshof stattlich ernährt hatte, litt Hunger, seitdem mit dem Aufkommen der Geldwirtschaft der Wert seines Landes gesunken war, ohne daß von den Hintersassen mehr Abgaben einliefen als früher. Diese kleinen Adligen hatten nun die Wahl, ihre Freiheit zu behalten, zu verhungern und Strauchritter zu werden oder sich in die Abhängigkeit von Fürsten und Städten zu begeben und diesen mit Lanze und Leben zu dienen. So stoßen wir im Solde Nordhausens auf Namen wie Heinrich von Wernrode, Heinrich von Werther, Friedrich von Wolkramshausen, Konrad von Schiedungen, Brassei und Albert von Scharfe, die nichts weiter als ihr Wappenschild besaßen und ihre Haut zu Markte trugen im Kampfe gegen ihre Standesgenossen, welche die Stadt befehdeten. Schon um 1300 begannen in Verbindung mit den thüringischen Wirren die Streitigkeiten um Nordhausen herum und sollten fünfzig Jahre lang kein Ende finden. Am 20. September 1302 ward der erste Waffengang zwischen der Stadt einerseits und den Honsteinern und Stolbergern andererseits bei Himmelgarten beigelegt, und die Grafen versprachen, sich nicht an denjenigen Adligen zu rächen, die auf der Seite der Stadt gefochten hatten.Als darauf die Nordhäuser Bürger einigermaßen Ruhe in ihrer eigenen Umgebung hatten, hielten sie es für ihre Bürgerpflicht, gemeinsam mit Erfurt und Mühlhausen überall in Thüringen da aufzutreten, wo bürgerliche Interessen von / Adligen geschmälert erschienen und wo es galt, der Macht des Landesfürsten Einhalt zu gebieten. So brach denn ein starker Bürgerhaufe, aus den Mannschaften der drei Städte gebildet, im Jahre 1304 auf, um einen der mächtigsten Dienstmannen Friedrichs und Diezmanns zu bekämpfen. Das war Burggraf Otto von Kirchberg, der drei feste Burgen bei Jena besaß und damit den Schlüssel zu der Tür in der Hand hielt, die Meißen und Thüringen verband. Der Zug gelang, die Burgen wurden gebrochen, die Verbindung des Stammlandes Meißen mit dem hinzuerworbenen Thüringen war für die fürstlichen Brüder dadurch unterbrochen, und ihre Sache stand bedenklich.[26] Dieser erfolgreiche Waffengang führte dann zu einem dauernden Bündnis der drei Städte im Jahre 1306. Das Kräfteverhältnis der drei Verbündeten kann man etwa daraus ersehen, daß sich 1308 Erfurt mit 250 Reitern und 510 Schützen, Nordhausen mit 40 Reitern und 20 Schützen den Mühlhäusern zu Hilfe zu kommen verpflichtete. Allerdings hatte Erfurt als gefährdetste Stadt auch ein ganz besonderes Interesse an diesen Unternehmungen, während Nordhausen durch seine Bündnispflicht eigentlich nur den Groll der adligen Herren Nordthüringens, die ausnahmslos Parteigänger Friedrichs des Freidigen waren, auf sich lud. So kämpfte denn Nordhausen auch 1306 um Eisenach und die Wartburg eigentlich nur aus treuer Waffenbrüderschaft zu Erfurt und Mühlhausen, es sei denn, daß das rauflustige Blut der vornehmen Geschlechter und ihrer Jugend nach Abenteuern Verlangen trug und ihnen die eingegangenen Verpflichtungen gerade recht waren. In dem nun schon jahrzehntelangen Streite der Könige um Thüringen, der Söhne Friedrich und Diezmann gegen ihren Vater Albrecht den Entarteten glaubten alle vorwärtsstrebenden Städte des Landes ihrer Untertanenpflicht ledig werden zu können, neben anderen Ortschaften selbst Eisenach am Fuße der thüringischen Residenz, der Wartburg. Als nun König Albrecht I. im Juli 1306 die beiden bedrängten Brüder Friedrich und Diezmann nach Fulda vor sein Gericht lud, diese aber der Aufforderung nicht folgten, weil sie vom Könige doch keine Anerkennung ihrer Ansprüche erwarteten, plante der König selbst einen Zug gegen Thüringen. Das war die rechte Zeit für die Städte, gegen ihre Landesfürsten loszuschlagen, und so unternahm es das freiheitsdurstige Eisenach für den König sogleich, die Wartburg zu belagern. Die gemeinsame Not führte kurze Zeit sogar den Vater und die ihm feindlichen Söhne zusammen, und Albrecht der Entartete hielt die Wartburg für seine Söhne gegen die Belagerer. Diese kamen aber dadurch in nicht geringe Verlegenheit, daß König Albrecht ausblieb, weil er die Regelung der Verhältnisse in Böhmen für dringender hielt als sein Eingreifen in Thüringen. Da war den Eisenachern die Hilfe der drei verbündeten Städte hochwillkommen. Gemeinsam legten sie sich vor die Burg, hofften sie nunmehr erobern zu können, dadurch dem Bürgertum zu nützen und zugleich den Dank des Königs zu verdienen. Doch es kam anders. Auch der schwer bedrängten Burg nahte Entsatz. Friedrichs des Freidigen Schwager Heinrich von Braunschweig nahte nämlich mit einem starken Haufen Ritter, schnitt den Belagerern die Zufuhr ab, brachte ihnen in einigen Scharmützeln nicht unerhebliche Verluste bei und zwang sie schließlich mit blutigen Köpfen zum Abzüge. Als nun gar am 31. Mai 1307 der königliche Hauptmann Heinrich von Nortenberg von Friedrich dem Freidigen selbst in dem entscheidenden Treffen bei Lucca in Sachsen geschlagen worden war, stand es um die Sache des Königs und damit auch der Städte aufs schlimmste. Da mußte sich denn König Albrecht doch selbst bemühen. Er rückte von Westen mit einem stattlichen Heere heran und schlug im Juli 1307 bei Mühlhausen ein Lager auf. Hier im Heerlager vor Mühlhausen belohnte er auch die beiden Reichsstädte für ihr treues Eintreten, natürlich mit einer Gabe, die ihn nichts kostete. Am 25. Juli ließ er durch einen Fürstenspruch Mühlhausen und Nordhausen für von Thüringen völlig unabhängige Reichsstädte erklären. Damit waren die Verpflichtungen, die Adolf von Nassau 1294 gegen Albrecht den Entarteten eingegangen war, endgültig erledigt. Des Königs Kriegszug kam aber auch in diesem Jahre nicht zur Ausführung, da wieder andere Reichsgeschäfte drängten; und im Jahre 1308 erreichte den Herrscher das schwarze Geschick bei seinem Übergange über die Reuß. Durch diese Gebundenheit des Königs und danach durch seinen Tod lächelte das Glück wieder Friedrich dem Freidigen. Zwar auch Albrechts Nachfolger, Heinrich VII. von Luxemburg, erhob Ansprüche auf das Land, zwar schadete ihm auch das trotzige Erfurt mit seiner Kriegsmacht, indem es manche Burg seiner adligen Anhänger rund um die Stadt herum ausräucherte, aber König Heinrich hatte andere, weitere, auf Italien zielende Pläne, und die Mühlhäuser und Nordhäuser, nicht so reich und auch nicht so bedroht wie Erfurt, machten allmählich Schwierigkeiten bei den weit ausschauenden Unternehmungen. Besonders die Kleinbürger Nordhausens waren kriegsmüde und murrten. So kam Friedrich der Freidige – sein Bruder Diezmann war in Leipzig ermordet worden – wieder oben auf, und nun sollten die Städte seine Faust zu fühlen bekommen. In ihrer Not wandten sich die beiden Reichsstädte an ihren königlichen Herrn um Hilfe. Dieser vermittelte auch bereitwillig, doch hätte dieser Einspruch des fernen Königs den Städten wahrlich wenig genützt, wenn Friedrich der Freidige nicht im Osten seiner Lande nach der Lausitz ausgeschaut hätte und ihn dort die Brandenburger nicht bedrängt hätten. So ward denn 1310 eine Sühne versucht; die in den Kämpfen gefangenen Nordhäuser sollten gegen Lösegeld zurückgegeben und Friede geschlossen werden. An Friedrich lag es nicht, wenn dieser Vertrag nicht gehalten wurde. Denn dieser ewig rastlose Mann lag jetzt in schwerstem Ringen um die Osterlande mit Waldemar dem Großen von Brandenburg. Der Kampf lief für ihn so unglücklich wie möglich aus. Er wurde von einer feindlichen Streife im Jahre 1312 selbst gefangen genommen und mußte nun am 13. April 1312 im Frieden zu Tangermünde seinen Verzicht auf die Lausitz, auf Landsberg und auf das Osterland aussprechen. Diese seine Not brachte alle seine Gegner wieder auf den Plan. Die Städte, im Jahre 1310 von ihm schwer bedrängt und zum Frieden bereit, standen nicht an, gegen den Gefährdeten loszuschlagen. Eine große Koalition: Die Äbte von Fulda und Hersfeld, die im alten, zwischen Hessen und Thüringen strittigen Grenzlande ihre Herrschaft hatten, Erfurt, das ewig kampflustige, schließlich auch Mühlhausen und Nordhausen brachen von neuem los. Sehr zum Schaden unserer Stadt Nordhausen. Die Chroniken berichten, Friedrich der Freidige sei selbst dahergezogen gekommen und habe die Fluren um Nordhausen herum verwüstet. Das ist unwahrscheinlich; doch er hatte streitbare Mannen genug, die seinem Wink und ihrem eigenen Gelüste gern gehorchten. Die Herren von Hackeborn, von Schraplau, von Querfurt, der Schenk von Nebra, Ludolf von Morungen, die Honsteiner, die Beichlinger, alles fiel über Nordhausen her, ehe es noch seine Mannschaft nach Thüringen schicken konnte. Da ward den guten Bürgern böse eingeheizt! Wieder mußte der Kaiser seiner Reichsstadt helfen. Er war zwar fern in Italien, doch machte er auch von dort gute Politik. Auf Nordhausens Hilferuf ernannte er am 5. Juli 1313 in Pisa den Gegner Friedrichs des Freidigen, den Brandenburger Heinrich von Landsberg, zu seinem Stellvertreter und befahl ihm, sich der Bürger anzunehmen. Alles konnte der Landsberger auch nicht mehr retten, doch ging es, wenigstens für Nordhausen, noch leidlich glimpflich ab. Beide Teile waren zu erschöpft, als daß sie nicht den Frieden ersehnt hätten. Erfurt büßte am meisten, es war auch am vorwitzigsten gewesen. Es mußte 1315 auf zahlreiche Gerechtsame verzichten und 10.000 M Silber bezahlen. Nordhausen gelang es, mit seinen Gegnern einzeln zum Frieden zu kommen. Am ehesten waren die Beichlinger befriedigt, denen es nur darauf ankam, aus den Händeln etwas herauszuschlagen. Sie wurden 1314 mit 50 M Silber abgefunden. Mit den Honsteinem söhnte sich die Stadt 1315 aus; besonders die Geldnot der Grafen führte zum Frieden und zum Verkauf eines Stückes honsteinschen Gebietes an die Stadt. 1317 ward dieser Vertrag durch eine nochmalige Sühne bekräftigt, fünf Nordhäusische Bürger und Söldner, die Honstein noch gefangen hielt, wurden ausgeliefert. Endlich im Jahre 1319 und 1320 kamen Mühlhausen und Nordhausen auch mit den großen Herren ins Benehmen; im Jahre 1319 begrub Friedrich der Freidige seinen Groll gegen die beiden Städte, und 1320 schloß Friedrichs Schwager, Heinrich von Braunschweig, der wacker an der Seite Thüringens gestanden hatte, mit der Stadt einen Vertrag. Der kluge Ludwig der Baier aber, der jetzt auf Deutschlands Thron saß, hatte schon am 11. März 1317 durch den Frieden von Magdeburg den Streit des Reiches mit Thüringen beigelegt, indem er auf eine seiner noch unerwachsenen Töchter schaute und deren Glück für später väterlich in Bedacht zog. Wie schnell man damals aber die blutigen Raufereien vergaß, geht daraus hervor, daß Friedrich der Freidige und seine grimmen Feinde, die Städte, schon 1321 in ungetrübter Freundschaft gemeinsame Politik trieben. Denn nachdem Friedrich 1317 endlich in den unangefochtenen Besitz Thüringens gelangt war, dachte er auch kein Spielzeug in den Händen seiner Vasallen zu sein. Er wollte als Landesfürst regieren; und damit Ruhe und Ordnung, Handel und Wandel in dem arg zerzausten Lande wieder Aufschwung nähme, konnte er das Stegreifreiten und die Fehden nicht mehr dulden. Als er erst einmal im Sattel saß, mußten vor seinem Throne Adlige, Bürger und Bauern gleich sein; nur so konnte sein Land gedeihen und damit seine eigene Macht. Nichts Schrecklicheres als Ordnung und einen starken Herrn konnte es aber für den ewig unruhigen, unfügsamen Adel geben. Da zauderte Friedrich nicht lange. Er wandte sich an die, die Friede und Ordnung für ihren Handel und ihr Gewerbe nötig hatten, und mit Hilfe der drei verbündeten Städte züchtigte er die Adligen einen nach dem anderen. So sorgte der Fürst, der während seines ganzen Lebens nur Unruhe gekannt, an seinem Lebensabend für Ruhe. Doch seine Nerven waren von den Anstrengungen zerrüttelt; bald darauf starb er in geistiger Umnachtung. Seine tapfere und edle Gemahlin Elisabeth hielt aber das freundliche Verhältnis zu den Städten aufrecht und setzte sich 1323 mit Nordhausen auch wegen des Schultheißenamtes friedlich auseinander. So gab es denn wenige Jahre lang ein Aufatmen. Die friedlichen Jahre um 1320 herum nahmen aber bald dadurch ihr Ende, daß Nordhausen am 7. Mai 1323 von Ludwig dem Baiern an seinen Schwiegersohn, Friedrich den Ernsthaften von Thüringen, verpfändet und das Schultheißenamt, abgesehen vom Schutze über die Juden, wenige Monate später den Honsteinem verliehen wurde. Dazu kamen die oben behandelten inneren Wirren und der Kampf mit der Geistlichkeit, der Nordhausen in den zwanziger Jahren an den Rand des Verderbens brachte. Nach Beilegung dieses Zwistes blieben noch immer 60 Nordhäuser Bürger aus der Stadt verbannt, irrten heimatlos und haßerfüllt in der Fremde und bildeten schließlich die treuesten Anhänger der Honsteiner gegen ihre frühere Vaterstadt. Es waren also für die Honsteiner genug Gelegenheiten gegeben, sich in die Verhältnisse der Stadt einzumischen: die Reichsämter waren in ihrer Hand, die Vogtei besaß Honstein-Sondershausen, das Schulzenamt Honstein-Klettenberg- Heringen, und Nordhäuser Bürger waren ihre Parteigänger. Doch auch noch andere Umstände bewogen sie, gegen Nordhausen einzugreifen. Während nämlich einerseits Nordhäuser Bürger die Honsteiner unterstützten, gab es andererseits draußen auf dem Lande unter ihren Lehnsleuten manchen kleinen Adligen, der sich nach einem ruhigeren Leben in der Stadt und nach einem weniger kümmerlichen Auskommen daselbst, als er es zur Zeit auf seinem Gute hatte, sehnte und deshalb mit den Bürgern sympathisierte. Zu diesen Adligen gehörte Günther von Salza, der am liebsten sein Land an die Stadt verkauft, mit dem Gelde ein bürgerliches und nahrhaftes Gewerbe begonnen, dadurch aber Ländereien dem Herrschaftsgebiet der Honsteiner entfremdet hätte. Schwere Gewitterwolken hingen also wieder über Nordhausens Himmel. Bei diesen inneren und äußeren Verlegenheiten suchte Nordhausen zunächst einmal die kleinen Kläffer abzuschütteln. Am 8. Mai 1324 gelang ihm von neuem mit den Beichlingern eine Sühne unter geschickter Ausnutzung des gespannten Verhältnisses, in welchem diese Grafen damals gerade zu den Honsteinem wegen Liegenschaften südlich und westlich des Kyffhäusergebirges standen. Ebenso war es möglich, die Regensteiner zu beschwören; doch waren diese 1329, als es etwas zu plündern und anzuzünden gab, wieder pünktlich und gewissenhaft auf dem Plane. Die Honsteiner hatten in den Jahren 1324-1326 den Bürgern während ihrer Fehde mit der Geistlichkeit nach Kräften Abbruch getan, versuchten aber nicht nur den Weg der Gewalt, um die Blüte Nordhausens zu knicken, sondern auch den Weg kluger wirtschaftlicher Förderung ihrer Lande. Deshalb erhoben sie das am Fuße eines ihrer Schlösser gelegene Dorf Heringen 1327 zur Stadt, hofften dadurch den Handel hierher zu lenken und den Nordhäusern ernsthaft Konkurrenz zu bereiten. Waffenbrüderlich stand der nördlichen Linie Honstein die südliche Sondershäuser zur Seite in ihrem Kampfe gegen die Stadt, und als im Jahre 1328 Honstein-Klettenberg mit der Stadt Mühlhausen in eine schwere Fehde verwickelt und deshalb für Nordhausen ungefährlich war, übernahm Sondershausen getreulich die Führung unter den Widersachern der Stadt. Es wurde der Plan gefaßt, die Ortskenntnis der vertriebenen Nordhäuser auszunützen und mit ihrer Hilfe in die Stadt selbst einzudringen. Am 14. April 1329 ward der Sturm auf die Stadt versucht. Leider hat ein ganzes Gespinst unglaubhafter Nachrichten über den Angriff die Überlieferung im Laufe der Jahrhunderte überzogen. Die einzig einwandfreie Quelle, der liber privilegiorum, berichtet nur: „60 vertriebene Bürger versuchten mit Hilfe zahlreicher benachbarter Ritter und Adligen, deren Führer Graf von Honstein-Sondershausen und die Herren von Stolberg und Beichlingen waren, mit großer Heeresmacht durch das Altentor feindlich einzudringen. Dabei wurden der Bürgermeister Helwig von Harzungen und drei andere Bürger getötet.“[27] Aus diesen und späteren Berichten ist einigermaßen einwandfrei auszumachen, daß die vertriebenen Nordhäuser das Altentor als die schwächste Stelle im Festungsring bezeichneten und sich selbst zu Führern erboten hatten. Das Tor wurde in der Tat überrumpelt, und die Verräter drangen die Barfüßer-Straße empor in die Stadt unter dem Rufe: „Hernach Honstein, hernach Honstein!“ Doch schon in der Barfüßer-Straße muß der Kampf zum Stehen gekommen sein. Vielleicht, daß nicht nur die waffenfähige Mannschaft Nordhausens alsbald den Eindringlingen im Straßenkampfe entgegentreten konnte, sondern daß auch die Bewohner der Straßenzeilen, in denen der Kampf tobte, zum Aufhalten der Feinde beigetragen haben. Unverbürgt ist allerdings, daß die Frauen den Angreifern heiße Maische auf den Kopf geschüttet haben und daß die Getöteten nach dem Kampfe in den Frankenbom auf der Kranichstraße gestürzt worden sind. Dagegen steht fest, daß es dem Bürgermeister Helwig von Harzungen ziemlich schnell gelungen ist, eine Schar mannhafter Bürger in die Hand zu bekommen und den Feind wieder hinauszudrängen. Es scheint fast so, als ob allein die abtrünnigen Nordhäuser über das Altentor hinaus in die Stadt vorgedrungen seien. Den adligen Herren war ja ein solcher Straßenkampf, bei dem sie von ihren Rossen steigen mußten und mit Lanze und Langschwert nicht viel ausrichten konnten, nicht allzusehr nach dem Sinne. Kurzum, der Angriff scheiterte vollkommen. Helwig von Harzungen, als Vorkämpfer im Streit, und drei weitere wehrhafte Bürger bezahlten allerdings ihre Treue zur Vaterstadt mit dem Tode. Doch eine große Gefahr für die Stadt war überwunden, und die Bürger wußten wohl, welches Schicksal ihnen um ein Haar geblüht hätte. Denn allen war nur zu gut bekannt, was die Erstürmung und Plünderung einer Stadt in jener Zeit mit sich brachte. Dementsprechend groß war nach überstandener Angst auch die Rache an den gefangenen Feinden und die Freude über die glücklich abgewandte Gefahr. „... captivantes ex iis aliquos in numero quasi quatuordecim, quos mortificarunt miserabiliter et rotarunt. “ Die 14 Gefangenen wurden aufs elendeste zu Tode gebracht, indem man ihnen die Knochen brach und sie aufs Rad flocht. Auch in der Beziehung bahnte sich das spätere Mittelalter an, daß die Sitten verrohten und man Gefallen fand an entsetzlichen Exekutionen; kein Wunder, wenn das Volk das nachahmte, womit ihm die königliche Familie zur Sühnung des Mordes an Albrecht I. mit schlechtem Beispiel vorangegangen war. Doch der Grundton war auf Jubel über die Errettung gestimmt. Man beschloß aus Dankbarkeit über die Rettung alljährlich am Freitag vor Palmarum ein großes Fest zu feiern, an dem jeder fröhlich sein sollte. Es ward an diesem Tage eine Prozession rings um die Stadt veranstaltet, danach in der Barfüßerkirche ein Gottesdienst gefeiert und für die Gefallenen eine Messe gelesen. Um den Tag aber für jeden zu einem Freudentage zu gestalten, ward eine reiche Spende gestiftet, aus der alt und jung, arm und reich alljährlich Gaben empfing. Die Statuten setzten genau fest, was jedem an diesem Spendefeste, nach dem die Barfüßerkirche fortan auch Spendekirche hieß, zufallen sollte. Die Geistlichen, Ratsherrn, Lehrer, Schüler, die Armen der Stadt, die Reiter und Schützen, die im Festzuge mitgingen, alle wurden mit Geldgeschenken, zum Teil aber auch mit Brot und Heringen bedacht; ebenso fiel auch für die Armen und Kranken in den Spitälern, vor allem im Martinihospital, eine schöne Liebesgabe ab. Der Rat veranstaltete in den ersten Jahrzehnten an diesem Tage auch ein großes Festessen, doch kam dieser Brauch später ab.

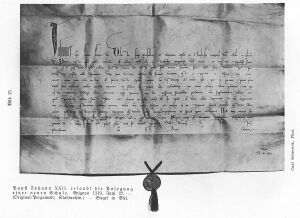
Dennoch bedeuteten diese dreißiger Jahre bis etwa zum Jahre 1338 hin gegenüber dem bösen vorhergehenden Jahrzehnt eine Entspannung und Entlastung. Nur dadurch war es auch möglich, die großen Summen aufzubringen, welche Nordhausen, das ja seit 1323 an Thüringen verpfändet war, Friedrich dem Ernsten schuldete. Im Jahre 1333 vermochte sich die Stadt mit Friedrich zu verständigen, und im folgenden Jahre leistete sie eine namhafte Abzahlung der schuldigen 3000 M Silber. Ganz eigenartig gestaltete sich das Verhältnis zwischen Nordhausen und der Grafschaft Honstein-Klettenberg in diesem Jahrzehnt. Die Grafen waren ja ständige Gegner Nordhausens gewesen, hatten aber an allen den letzten Fehden gegen die Stadt nicht teilgenommen, obgleich sie mit der Erklärung Heringens zur Stadt im Jahre 1327 gegen Nordhausen zum mindesten einen unfreundlichen Akt vorgenommen hatten. Diese Haltung hatte ihre guten Gründe. Zunächst war es der Kampf mit Mühlhausen gewesen, der sie zum Stillehalten gezwungen hatte, dann aber auch ihre ewige Geldnot, unter der sie litten und die offenbar durch die Mühlhäuser Fehde nicht geringer geworden war. Sie schuldeten schon einer ganzen Reihe von Nordhäuser Patrizierfamilien bedeutende Summen und sahen keinen Ausweg, sich dieser zu entledigen. Ja, Graf Heinrich IV. wandte sich sogar 1333, als die Nordhäuser auf Zahlung drängten, beschwerdeführend an Papst Johann XXII. nach Avignon und bat ihn, den Bürgern das unchristliche Mahnen und das von der Kirche sogar verbotenen Zinsennehmen zu verbieten. Johann XXII., selbst ein außerordentlicher Geschäfts- und Geldmann, scheint aber einiges Verständnis für das kaufmännische Gebahren der Nordhäuser gehabt und nicht allzuviel im Sinne der Grafen getan zu haben. In ihrer Not verfielen die Honsteiner schließlich auf den Plan, ihr Schultheißenamt und die Münze zu Nordhausen, die ja seit 1323 in ihrem Besitze war, möglichst auszunutzen und auf diese Weise den Bürgern das abzunehmen, was sie als vornehme Herren von den Krämern doch eigentlich verlangen konnten. Unterdessen erlebte die Stadt aber noch ein kleines Zwischenspiel mit ihrem kaiserlichen Herrn Ludwig dem Baiern. Man denke: die Unruhen drinnen und draußen, die fortwährenden Aderlässe durch das Loskaufen aus den Verpfändungen, die kostspieligen Bauten an Befestigungen und öffentlichen Gebäuden, der Wunsch, die Stadtflur zu erweitern, die Darlehen an die Honsteiner, – was für Geldsummen waren dazu erforderlich, und wie außerordentlich rührig und hoffnungsfroh war die Stadt, die das alles zuwege brachte, eine Stadt, deren Einwohnerzahl die 3000 kaum überschritten hatte! Denn nur etwas mehr als 400 Häuser sind für das damalige Nordhausen nachweisbar, in denen 500-600 Familien gewohnt haben mögen. Bei allen diesen Unternehmungen und Ausgaben war man aber froh, daß man nicht auch noch ans Reich zu zahlen hatte. Man hatte schon genug getan, wenn man von Zeit zu Zeit die Schulden des Kaisers dadurch abtragen half, daß man sich aus der Pfandschaft löste, – zu irgendwelchen anderen Opfern für das Reich wollte man sich also nicht bequemen. Des Reiches Stadt nannte man sich gern, und gehorsam war man dem Kaiser, aber Kosten durften damit nicht verbunden sein. Nun gebrauchte der Kaiser aber Geld und Truppen zu seinen Unternehmungen in Tirol und in Mähren, am Rhein und in Italien, und deshalb legte er seinen Reichsstädten Umlagen auf. Nordhausen dachte aber gar nicht daran, dem fernen Kaiser Geld zu senden, ja selbst die Steuer, welche die Juden als des Reiches Kammerknechte zu entrichten hatten, zogen sie zwar ein, führten sie aber nicht ab. Ob dieser Mißachtung erzürnt, sandte der Kaiser seinen Sekretär Johann von Augsburg nach Nordhausen, der die Stadt am 5. August 1336 vor des Kaisers Gericht laden mußte. Wenn sie, um sich zu verantworten, keinen Vertreter schickte, sollte Nordhausen geächtet werden. „... wellen wir iuch in diu Ohte (Acht) künden und wellen iuch und iw’ gut gemainlich offen und erlouben allermeneclich als recht Ohte; wir wellent iw dar za nemen und och entw’en aller d’vriheit, gnade, ere und och alt’ guter gewonhait....“ Das war eine böse Drohung, ja, sie wurde sogar, als Nordhausen keine Schritte unternahm, wahrgemacht und Nordhausen geächtet. Dieses Druckmittel verfehlte ja einer kleinen Stadt wie Nordhausen gegenüber, die im Augenblick der Achtsverhängung sofort allen räuberischen Anfällen schutzlos preisgegeben war, nie seine Wirkung. So mußte denn auch diesmal Nordhausen sich beugen und dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Darauf zeigte sich dieser sehr entgegenkommend, verzichtete sogar zu Gunsten der Bürger am 24. Oktober 1337 auf den ihm zukommenden Judenzins und befahl dem Schultheißen Nordhausens, dem Grafen von Honstein, die über die Stadt verhängte Acht aufzuheben. Das geschah am 19. September 1338.[29] Das war ein kleines, wahrscheinlich für die Stadt aber wiederum mit erheblichen Opfern verknüpftes Zwischenspiel. In diesen Jahren begann sich nun aber auch das Verhältnis zu den Honstein-Klettenbergern eben wegen der Geldverlegenheiten der Grafen zu trüben. Zunächst gingen die Grafen dazu über, in der Münze zu Nordhausen Geld von geringerem Schrot und Korn herstellen zu lassen, um die aus der Verschlechterung der Münze stammenden Überschüsse in ihre Tasche fließen lassen zu können. Dadurch schädigten sie natürlich den Nordhäuser Handel alsbald empfindlich; die Einsprüche der Nordhäuser beachteten sie nicht. Dann hielten sie ihr Schulzengericht aber auch nicht in der Stadt, sondern widergesetzlich draußen in der Grafschaft ab und beugten dort das Recht, um von den Bürgern möglichst hohe Strafsummen einziehen zu können. Als nun wegen dieser Mißstände der Unwille der Nordhäuser stieg und es zu kleinen Reibereien kam, begannen sie den Nordhäusern ihre Halsstarrigkeit gehörig einzutränken. Zunächst untergruben sie damit die Autorität der Nordhäuser Ratsherren, daß sie sich offenkundig der vertriebenen Bürger annahmen, ein Vorgehen, das in diesen Jahren der Ständekämpfe stets den größten Groll hervorrief, da es ja den Widersetzlichen in der Stadt den Nacken steifen und so der ganzen bestehenden Ordnung gefährlich werden mußte. Dann benutzten die Grafen aber auch die alten bewährten Druckmittel, sperrten die Straßen, störten den Handel, nahmen Bürger gefangen und steckten sie in ihre Verließe, um Geld zu erpressen, fingen Klagebriefe der Stadt, welche diese wegen der Gewalttaten an den Kaiser richtete, ab und führten die Boten gefangen auf ihre Burgen. Unermeßlicher Schaden erwuchs der Stadt aus diesem Zwist mit ihrem Schultheißen. Schließlich gelang es der Stadt doch, ihre Klage vor den Kaiser zu bringen. Sie wurde 1342 vom Kaiserlichen Hofgericht als voll berechtigt anerkannt und den angeschuldigten Grafen schwere Buße auferlegt. Die Honsteiner mußten das Doppelte des festgesetzten Schadens, 4000 M, Buße zahlen, und das Recht auf das Schultheißenamt wurde ihnen abgesprochen. Ludwig gab es an den alten Besitzer des Amtes, an den Landgrafen Friedrich von Thüringen.[30] Dieser Spruch hätte die Nordhäuser recht befriedigen sollen; sie glaubten aber nach ihrem Erfolge noch größere Freiheiten erlangen und das für die Stadt so überaus wichtige Schulzenamt ganz in ihre Hände bringen zu können. Da aber auch Honstein seine Rechte nicht ohne weiteres herausgab, bewarben sich eigentlich drei, Thüringen, Honstein und Nordhausen, um das Amt. Der Streit dauerte bis 1352, wo Thüringen auf friedliche Weise den Honsteinern die Gerechtsame abkaufte und König Karl IV., der Nachfolger des Baiern, den Nordhäusern ernstlich befahl, die Auflassung des Schulzenamtes an Thüringen anzunehmen, sonst müsse er dem Landgrafen die gewaltsame Besitzergreifung gestatten. Seitdem war das Schulzengericht mit Thüringen verbunden, und als 1423 die Wettiner Thüringen mit Meißen vereinigten, übernahm dies Geschlecht auch Thüringens Rechte an Nordhausen. Das im Augenblick für Nordhausen Wesentliche war jedoch, daß die Honsteiner gezwungen waren, einzulenken. Ihre Schulden, die sie bei Nordhausen hatten, waren nicht verringert worden, sondern hatten sich noch vergrößert. 1344 betrugen sie 5744 M lötiges Silber, für die sie jährlich allein 600 M Zinsen aufbringen mußten. Da das an barem Gelde nicht möglich war, blieb ihnen nichts weiter übrig, als einer Reihe Nordhäuser Patrizier Dörfer und Schlösser zu verpfänden. Darunter waren Ober- und Niedergebra, Schloß Lohra, Sollstedt, Nohra, Groß- und Kleinwenden u. a. Die gegenseitige Abhängigkeit verband wiederum die Stadt und die Grafen. Als „Landfriedensbewahrer“ riefen die gräflichen Brüder Heinrich, Dietrich, Bernhardt und Ulrich die Landschaft und ihre Städte auf, Räuber und Friedensbrecher, deren es in jenen Zeiten genügend gab, aufzusuchen und zu züchtigen. Auch Nordhausen leistete 1344 diesem Rufe Folge, zog gemeinsam mit den Honsteinern vor die Heinrichsburg bei Harzgerode und wirkte an der Einnahme und Zerstörung mit. Überhaupt lagen damals im Harze, fern von bewohnteren Gegenden, eine ganze Reihe von Raubnestem, in deren Unzugänglichkeit sich die Stegreifritter und ihre Spießgesellen sicher wähnten. 1346 gab es schon wieder einen Zug gegen Raubritter. Diesmal galt es der Erichsburg bei Güntersberge im Harz; doch scheinen sich nicht die Nordhäuser, sondern nur Erfurter und Mühlhäuser an dem Unternehmen beteiligt zu haben. Auch dieses Raubnest wurde gebrochen, und mit den Insassen geschah, was Rechtens war: die adligen Strauchdiebe wurden geköpft, ihre Reisigen an den schönen, knorrigen Bäumen um die Burg herum aufgeknüpft. So schien denn in den vierzig Jahren endlich Recht und Friede einzuziehen. Nordhausen blühte nach den letzten Schlägen sichtlich auf, die Bürger konnten sich wieder gestatten, stolz und sicher einherzuschreiten, und ihr Selbstbewußtsein wurde in diesen Jahren nicht wenig dadurch gefördert, daß sie selbst der Kirche gegenüber einmal recht behalten sollten. Am Halbach oder Rossungsbach hatte aus Anlaß eines Wunders Elger von Honstein, Propst des Kreuzstiftes zu Nordhausen, im Jahre 1295 das Augustinerkloster Himmelgarten gestiftet. Das neue Kloster wurde mit Mönchen aus dem Paradieskloster in Hasselfelde besetzt. 1309 schenkten die Honsteiner ihm die Fluren des 1294 im Adolfschen Kriege eingegangenen Dörfchens Rossungen. Bald darauf schienen sich den Mönchen zwei Hofstellen in der Töpferstraße zu Nordhausen zum Ankauf zu empfehlen. Es heißt zwar, daß die Einsamkeit die Sammlung des Geistes befördert; aber den Mönchen, denen es schon in Himmelgarten besser gefiel als in der Einöde oben im Harze, glaubten wohl, willensstark wie sie waren, ihre geistlichen Verrichtungen durchaus mit den Ablenkungen des städtischen Getriebes vereinbaren zu können. Zunächst machte jedoch die Stadt Nordhausen, die ja gegen den Übergang weltlichen Besitzes in geistliche Hand schärfste Bestimmungen erlassen hatte, Einwendungen. Doch die frommen Brüder wußten die sorgliche Stadt zu beschwichtigen, versprachen, außer diesen Hofstätten keine Erwerbungen in Nordhausen zu machen, auf den Grundstücken keine Gebäude mehr, vor allem keine Kapelle, zu errichten und sagten schließlich sogar zu, daß sie, wenn ihnen Gelände in der Stadt fernerhin geschenkt werden sollte, dieses binnen Jahresfrist an die Stadt verkaufen wollten. Nun, die Mönche ließen einige Jahre darüber verstreichen und hielten sich harmlos und still, bis 1337 der Prior Johann den Grundstein zu einem Kirchlein in der Töpferstraße legte. Zu drei Mönchsklöstern in der kleinen Stadt, den Franziskanern, Dominikanern und den Augustinern in der Neustadt, noch ein viertes, das natürlich abgabenfrei sein mußte, den Gläubigen zahlreiche Spenden entlockte und, reich geworden, womöglich Anspruch auf städtischen Grundbesitz erhob! Sogleich schritt der Rat ein, wies auf den einstmals abgeschlossenen Vertrag hin und verbot den Bau. Unser Prior hatte sich aber vorgesehen und schon vorher vom Kaiser Ludwig eine Genehmigungsurkunde eingeholt. Als der Rat diesen kaiserlichen Erlaß für erschlichen erklärte, griffen die Mönche zu geistlichen Hilfsmitteln und ließen die Stadt, allerdings offenbar nur von untergeordneten Stellen, exkommunizieren. Im Gefühl ihres Rechts wandten sich die Nordhäuser an ihren Diözesan, den Erzbischof 7/emric/i von Mainz. Dieser sah den Unfug der kirchlichen Strafe auch sogleich ein, hob den Bann am 28. April 1338 auf, verfügte aber, daß die Kirche unter seiner bischöflichen Aufsicht bestehen bleiben sollte. Von diesem Spruch war nun keiner der beiden Teile, weder Mönche noch Bürger, befriedigt, und beide wandten sich an die höchste Instanz, an den Papst. Dieser bestimmte ein geistliches Schiedsgericht von drei Richtern, und nun gingen die Verhöre, Zeugenvernehmungen, Erkundigungen, selbst das Wechseln der Richter während des jahrelangen Streites los. Schließlich, am 11. März 1345, kam es aber unter dem Vorsitz Hartungs von Northoven, Scholasters des Marienstifts zu Erfurt, doch zum Spruche: die Mönche mußten die Kirche, das Klostergebäude und den Altar, den sie auf ihren Hofstätten errichtet hatten, abbrechen. Die Freude der Nordhäuser, zu diesem Ende gekommen zu sein, drückt sich nirgends besser als darin aus, daß sie in einem Vergleiche den Mönchen sogleich die gesamten Prozeßkosten, zu denen sie auch noch verurteilt waren, erließen.[31] Die geplagte Stadt hatte also in den vierziger Jahren Ruhe und schöne Erfolge. Doch wenn die Menschen einmal aufhören, sich gegenseitig zu plagen, dann ist immer noch zu Glück und Frieden die Huld des Himmels nötig. Der schickte damals aber furchtbarstes Ungemach. Der schwarze Tod, die Pest hielt ihren Einzug im westlichen Europa und schlug die Menschen schlimmer, als Menschen jemals schlagen können. Es ist seltsam, daß nicht die geringste Nachricht von dem großen Sterben in Nordhausen selbst auf uns gekommen ist; nur von Thüringen heißt es, daß dort der schwarze Tod gewütet habe. Dennoch wird Nordhausen nicht verschont geblieben sein, wenn auch nirgends sichtbar wird, daß die Pestzeit irgendwelchen Einfluß auf die Lebensgewohnheiten der Einwohnerschaft ausgeübt hätte. Im Gegenteil, selbst das Mißtrauen der Stände gegeneinander und der Haß der regierenden Geschlechter gegen die vertriebenen Bürger bestand ruhig weiter, wie aus einem Vertrage ersichtlich ist, den die Stadt mit Honstein-Sondershausen über ihre Grenzen im Jahre 1348 abschloß. Die Grafen gelobten darin nämlich der Stadt „Schutz und Treue“ gegen ihre Widersacher, „sonderlich die aus der Stadt gewichen sind“, und versprachen, im Süden nicht die Helme, im Westen nicht die Salza, im Norden nicht die Linie Crimderode-Petersdorf, im Osten nicht den Roßmannsbach und die Grenze von Sundhausen zu überschreiten. Wirklich berührt zu sein scheint Nordhausen nur von den Judenverfolgungen im Verlauf der Pestzeit. Alte Jahrbücher berichten darüber folgendes: „In diesem Jahre war ein großes Sterben in Thüringen, und weil man die Juden in Verdacht hatte, daß sie die Brunnen vergiftet, wurden sie allenthalben erschlagen und verbrennet, desgleichen auch hier geschehen, und selbige mit Weib und Kind weggejagt und das ihrige geplündert wurde; sonderlich wurden sie auf Lichtmessen und in der Fasten über Gotha, Eisenach, Kreuzberg, Arnstadt, Ilmenau, Nebra, Wiehe, Tennstädt, Gerbsieben, Thomasbrück, Frankenhausen und Sondershausen alle miteinander erschlagen. Der Rat zu Erfurt hatte den aufgestandenen Bürgern Einhalt getan, aber nichts desto weniger sind ihrer, der Juden, bei 400, andere sagen 3000 zusammengelaufen und ihre eigenen Häuser angesteckt und sich miteinander verbrennet.“ – In Nordhausen gab es im 14. Jahrhundert eine kleine jüdische Gemeinde, deren Mitglieder recht wohlhabend gewesen sein müssen; konnten sie doch allein Geld auf Zins ausleihen, was den Christen nach den Satzungen der Kirche verboten war. Und dieses Geschäft brachte bei den hohen Zinsen und dem Bedarf nach Geld viel ein. Denn die Bürger brauchten es zu ihrem Geschäft und die Adligen zu ihrem Vergnügen. Die Stellung der Juden als Ungläubige und Mörder des Heilands war die denkbar verachtetste, und zeitweise sah man sie nicht besser als Freiwild an. Da sie aber der Stadt zinsen mußten, hielt der Rat seine Hand über diese Einnahmequelle und verbot den Bürgern, seine Juden gar zu sehr auszubeuten und zu peinigen. „Swelich bürgere einen unsern iudin roft (rauft) oder siet oder ereliche stozzit, wer daz tout, der gibt dra phunt unn rumet 8 Wochen. “ Wer einen Juden tätlich angriff, mußte 3 Nordhäuser Silbermark bezahlen und 8 Wochen die Stadt räumen. Als dann 1337 Kaiser Ludwig „für sich und alle seine Nachkommen“ auf die Kopfsteuer, welche die Juden bisher an ihn hatten entrichten müssen, zu Gunsten der Stadt verzichtete, wurden die Juden dem Rate noch kostbarer. So scheinen sie denn einigermaßen unbehelligt ihren Gottesdienst in ihrem Jüdenhause in der Hütersgasse haben verrichten können. In der Nähe ihres Gotteshauses lag auch ihr Friedhof in dem Stadtgraben, der sich vom Petersberge nach der Rautengasse herunterzog. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts verlegten sie dann, wahrscheinlich weil sie noch wohlhabender geworden waren, ihre Judenschule in die Jüdenstraße, die danach ihren Namen erhielt. Erst aus dem 15. Jahrhundert ist eine dritte Stelle für die jüdische Synagoge in der Kickersgasse, der heutigen Neuen Straße, bezeugt. Waren die Juden beim Adel und den vornehmeren Bürgern nur verachtet, so waren sie von dem niederen Volke, das in seinem Aberglauben ihnen alle möglichen Verbrechen andichtete, gefürchtet und ihm verhaßt. Schon 1324 war ihre Schule von einem skandalsüchtigen Haufen geplündert worden. Jetzt, in den Pestjahren, wurde dieser Unwille und diese Angst des Volkes vor den Juden dadurch für diese gefährlich, daß die Inhaber der Staatsgewalt den Verfolgungen die amtliche Genehmigung erteilten. Der Nordhäuser Rat hatte sich vernünftigerweise lange Zeit recht gleichgültig gegen die Judenhetze auf dem Lande verhalten. Man sticht nicht gern eine Kuh in dem Augenblicke ab, wo sie am meisten Milch gibt. Nun schrieb aber der Schutzherr der Stadt, Landgraf Friedrich von Thüringen, am 2. Mai 1349, in Thüringen seien alle Juden „verderbt“ worden, weil sie die Brunnen vergiftet und dadurch die Pest hervorgerufen hätten. Die Nordhäuser sollten nun endlich auch ans Werk gehen. Er werde zur Anklage Heinrich von Snoze, seinen Vogt in Salza, schicken. Jetzt entwickelte sich das Drama binnen wenigen Tagen zur Katastrophe. Der Rabbi Jakob wurde auf das Rathaus befohlen, die Schandtaten seiner Gemeinde wurden ihm daselbst vorgehalten, und obgleich er seine und seiner Glaubensgenossen Unschuld beteuerte, wurde ihm doch verkündet, alle Nordhäuser Juden sollten sich bereithalten, den Feuertod zu erleiden. Über den Vorgang, der sich nun am 5. Mai 1349 am Judenfriedhof auf dem Rähmenplatze abspielte, liegt ein späterer Bericht von jüdischer Seite vor, der ein hohes Lied auf den Opfer- und Glaubensmut der Nordhäusischen Judenschaft singt, aber ganz offensichtlich tendenziös gefärbt ist. Karl Meyer hat ihn in seiner Geschichte der Nordhäuser Juden abgedruckt. Der Rabbiner habe sich vom Rate die Musiker der Stadt ausgebeten, habe mit seinen Glaubensangehörigen vor der Synagoge in der Jüdenstraße einen Festzug gebildet, und unter Spiel und Freudengesang sei es dann zur Richtstätte gegangen. Auf dem Judenfriedhof sei eine gewaltige Grube, angefüllt mit Holz und Reisig, gegraben gewesen; darüber seien Bretter gedeckt worden. Diesen Platz hätten alle Juden, auch die Wöchnerinnen und Kinder, betreten; dann habe auf Befehl des Rabbiners die Musik eingesetzt, auf Befehl des Rates sei das aufgestapelte Holz angezündet worden. Unter Gesang und Tanz hätte die gesamte jüdische Gemeinde dann solange auf den Dielen ausgeharrt, bis diese angeschwelt worden seien, nachgegeben hätten und Beter und Bretter in die Glut gestürzt seien. Wenn wir nun auch nicht glauben können, daß sich der Hergang so gestaltet habe, so ist durch mannigfache Überlieferung doch gewiß, daß die verfolgten Juden mit außerordentlicher Fassung und großem Bekennermut ihr Schicksal auf sich genommen haben. Sicher haben auch die meisten Nordhäuser Juden in den Flammen ihren Tod gefunden, einige werden aber verschont worden sein oder sich haben retten können. Ebenso wie der Erfurter Rat, der seine Juden vor der Wut des Pöbels zu schützen bestrebt war, wird auch der Nordhäuser Rat gehandelt haben. Nur dem durch die Seuche aufgeregten Volke und dem Befehle des Landgrafen mußten Opfer gebracht werden. Daß sich in der Tat viele Juden haben in Sicherheit bringen können, geht auch daraus hervor, daß sich schon 1350 wieder ein allerdings getaufter Jude in Nordhausen friedlich niedergelassen hatte, Laurentius, quondam Judaeus. Bald kamen auch die ungetauften wieder, und ihr Pferdehandel und Zinsverleihen gedieh nach wie vor ganz prächtig, so daß es ein Menschenalter nach der großen Judenverfolgung der eifrige Jäger und Trinker König Wenzel an der Zeit hielt, ihnen einmal wieder einen kleinen außerordentlichen Tribut aufzuerlegen. Im Jahre 1390 verfügte der König nämlich, daß alle Schuldner von Juden ihrer gesamten Schuld los und ledig seien, für diese Gnade aber an ihn eine Geldsumme abzuführen hätten. Anfang des Jahres 1391 machte auch Nordhausen von diesem trefflichen königlichen Erlaß Gebrauch, und am 9. März 1391 bekundete Wenzel, daß er sich von dem Vorgehen der Nordhäuser durchaus befriedigt fühle. Nachdem die Schrecknisse der Todesjahre 1348 und 1349 überwunden worden waren, kehrte wieder Beruhigung in die Bürgerschaft ein. Die fünfziger Jahre des 14. Jahrhunderts waren ähnlich friedlich wie die vierziger Jahre. Selbst die Reibungen innerhalb der Bürgerschaft, die nun seit 30 Jahren ununterbrochen gewährt hatten, hörten ums Jahr 1350 herum zeitweilig auf, nachdem der Rat den Zünften gewisse, aber auf die Dauer unzulänglich erscheinende Zugeständnisse gemacht hatte. Alle Lebensverhältnisse nahmen für kurze Zeit ausgeglichene Formen an. Nicht wenig trugen die beiden schon oben erwähnten Privilegien Karls IV. vom 10. August 1349 und 10. September 1354 dazu bei, durch welche die Rechtsprechung völlig an den Rat überging und Vogt und Schultheiß als Vorsitzende des Blutgerichts und Zivilgerichts nur noch als Staffage dienten. Damals konnte die Stadt deshalb auch nochmals darangehen, ihre Gesetze auszubauen. Die Bürger ergänzten die Statutensammlung vom Jahre 1308 und paßten ihre Gesetze den Bedürfnissen der neuen Zeit an. Schließlich diente auch der Befestigung aller Verhältnisse ein wichtiger Vertrag, den die Stadt mit ihrem Schutzherrn Friedrich dem Strengen von Thüringen am 3. April 1351 abschloß, als sie endlich sah, daß sie ihn doch als Inhaber des Schulzenamtes anerkennen mußte. Friedrich bekannte darin, „daß er den Bürgern von Nordhausen helfen will, gegen ihre Feinde, mit Ausnahme des Reichs, des Stifts und des Bischofs von Mainz, mit 20 Mann mit Helmen und 10 Schützen.“ Schiedsrichter in Streitigkeiten der Stadt oder gegen dieselbe sollen von Seiten des Landgrafen Jan von Lengefeld und Ritter Konrad Wurm, von Seiten der Bürgerschaft die Bürger von Nordhausen Hermann von Torstadt und Dietrich von Ellrich sein. Die Bürger sollen bei ihren verbrieften Rechten und Freiheiten bleiben. Der Landgraf will die Bürger auf den Landstraßen nicht hindern, sondern sie schützen. Wenn sie einander zu Hilfe auffordem, sollen sie binnen 14 Tagen kommen. Die Leute des Aufgeforderten sollen verpflegt werden. Erlittenen Schaden soll jeder selbst tragen; Gewinn aber soll man teilen nach der Zahl der Teilnehmer vom Zuge. Nimmt der Landgraf selbst oder einer der Herren oder sein Hauptmann teil am Streite, so erhält den besten Gefangenen der Landgraf, den folgenden die von Erfurt, darauf die von Mühlhausen und die von Nordhausen; die übrige Teilung geht wieder nach der Zahl der Mannen. – Also das richtige Verhältniswahlsystem zur Teilung des Lösegeldes. – Eroberte Festen, die dem Landgrafen zu Lehen gehen, bleiben ihm; andere werden gebrochen, wenn man nichts anderes darüber beschließt. Streitigkeiten der Teilnehmer an der Einung (Streitigkeit unter denen, die den Vertrag eingegangen sind) werden durch vier Schiedsrichter entschieden. Wollen noch andere in das Bündnis treten, so soll das mit Zustimmung der Teilnehmer geschehen. Suchen die Bürger ein Recht an einem Landgräflichen, so soll der Landgraf ihnen in einem Monat zum Rechte verhelfen. Sind die vier Schiedsrichter nötig, so sollen sie einreiten zu Weißensee oder zu Gotha und in 8 Tagen Recht oder Minne sprechen. Geht einer der vier Schiedsrichter ab, so wählt der betreffende Teil einen anderen, sendet ihn auch, wenn einer zu kommen behindert ist.[32] Am 8. Juli 1354 erteilte der König diesem Schutz- und Trutzbündnisse der Stadt mit dem Landgrafen Friedrich seine Zustimmung und versprach zugleich für sich und alle seine Nachfolger, die Stadt solle nie wieder verpfändet werden, sondern stets des Reiches Stadt bleiben. Dieses Versprechen wird Nordhausen nach den Erfahrungen der letzten 60 Jahre außerordentlich gefreut haben. Alle diese diplomatischen Handlungen dienten nicht wenig der Befriedung, und im Frieden gediehen Wohlstand und Ansehen. In dem ganzen Gebiet zwischen Harz und Thüringer Waldgebirge gab es nach Erfurt und neben Mühlhausen keine Stadt von der Bedeutung und Geltung wie Nordhausen. Das sprach sich auch in den Vermittlerrollen aus, die Nordhausen in diesen Jahren mehrfach übernehmen mußte. In Mühlhausen war der Zwist zwischen Geschlechtern und Handwerkern schon offen zum Ausbruch gekommen; die Stadt hallte wider vom Aufruhr. Da griff Nordhausen ein und vermittelte am 11. März 1351. Kurz danach kam Mühlhausen in schwere und blutige Auseinandersetzungen mit dem Grafen Heinrich von Honstein-Sondershausen. Als es keinen Ausweg aus dem Geflecht von gegenseitigen Beeinträchtigungen mehr zu geben schien, gab der Kaiser am 12. März 1354 den Städten Erfurt und Nordhausen den Auftrag zu vermitteln. Überall zeigt sich: Die Fürstenmacht begann sich endlich durchzusetzen und befriedete die Bürger, und beide zusammen befriedeten das Land. So klingt dieser Abschnitt aus. Den aber, der deutsche Geschichte überdenkt, muß es mit größter Bewunderung erfüllen, wenn er die Leistungen der burgenses, der führenden bürgerlichen Geschlechter, in dem ersten Jahrhundert deutschen Städtewesens überschaut. Es waren Zeiten voll Kampfgetümmel, voll Rauch und Mord, voll innerer Unruhe und äußerer Kriege. Die Opfer an Geld und Blut, die es kostete, bis sich die deutsche Stadt durchsetzte, waren ungeheuerlich. Und dennoch haben diese vollsaftigen, tatenfrischen Geschlechter Einzigartiges und Bleibendes geschaffen. Damals wurden die erhabensten Baudenkmäler, die Deutschland aufzuweisen hat, emporgezogen: Der Kölner Dom entstand und, wenn wir an unsere Heimatprovinz denken, der Dom zu Magdeburg. Reiche Patriziergeschlechter schufen den großen Rathaussaal zu Nürnberg und den Artushof in Danzig. Was in derselben Zeit Nordhausen, jeder deutschen Stadt darin ähnlich, gelitten und geleistet, haben wir erfahren. Aber selbst die Kräfte jener starken Geschlechter waren überspannt, die Nerven zu gewaltig belastet worden. Das Volk, dem unerhörte Opfer immer wieder von neuem zugemutet wurden und das für sich selbst daraus doch nur geringen Vorteil erwachsen sah, hielt schließlich nicht mehr durch. Dennoch hat in ähnlich großartiger Weise wie im 14. Jahrhundert die deutsche Stadt Eigenes, aus sich heraus Entwickeltes nur noch im 16. Jahrhundert und dann wieder seit unserer Jahrhundertwende hervorgebracht.
|
