Vom alten Brauchtum in den Landen zwischen Harz und Hainleite
|
Vom alten Brauchtum
in den Landen zwischen Harz und Hainleite.
Von
Hans Silberborth.
Alle Völker ohne Ausnahme werden mehr durch Sitten und
Ein ganz besonders farbenschillerndes, krauses Bild bietet unsere Volkheit dar, wenn wir ihr noch heute in fröhlicher Ursprünglichkeit allenthalben blühendes, aber von allem möglichen Kraut und Unkraut überwuchertes Leben durch alle die tausend Fasern und Adern bis in seine vielverzweigten und vielverborgenen Wurzeln zurückverfolgen. Nicht leicht ist es, da Ordnung und Klarheit hineinzubringen, und es ist wohl verständlich, wenn die Wissenschaft der Volkskunde immer wieder versucht hat, von einem Punkt aus das ganze Gestrüpp zu durchleuchten und zu durchdringen, weil ein Absuchen von mehreren Ausgangspunkten aus nur neue Verwirrung im Gefolge zu haben schien. So hat es Grimm versucht, unser gesamtes Brauchtum aus der germanischen Mythologie abzuleiten; Mannhardt hat gezeigt, wie stark urmenschliche Vorstellungen von Vegetationsgeistern noch heute nachwirken. Heute gehen manche Forscher noch weiter in die Anfänge menschlicher Lebensgestaltung zurück und führen noch heute geltenden Brauch auf urzeitliche Furcht vor Toten und Dämonen zurück; was sie aber dabei nicht einordnen können, soll zuweilen nichts weiter als jugendliches, erst in den letzten Jahrhunderten gesunkenes Kulturgut sein, d. h. ein Brauchtum, das einstmals gehobenen Ständen eignete, dann aber, vom Volke vielfach mißverstanden, nach seinem Geschmacke umgebildet und, mit seinen Mitteln ausgestattet, übernommen worden ist. Wieder andere sehen beinah in jedem Brauche kultische Opfer, und noch andere wollen die meisten Handlungen als alten Fruchtbarkeitszauber deuten. Gewiß eröffnet jeder Durchschlag durch das Urdickicht einen Ausblick, aber der Ausblick läßt nur einen Ausschnitt klar erkennen, und das übrige bleibt ihm verhüllt. Bei der Durchforschung unseres Brauchtums müssen wir doch wohl mehrere Ansatzpunkte wählen und versuchen von da aus, unter Vermeidung von verschlungenen Irrgängen, auf mehreren Wegen zum Ziele zu gelangen. Dabei ist gerade auf dem Gebiete der Volkskunde, die deutsches Gemütsleben erschließen soll, nichts nötiger, als daß der Forscher nicht nur mit dem Verstände in deutsche Wesensart einzudringen bemüht ist, sondern diese Wesensart mit seinem Herzen nacherlebt und miterlebt. Nur darf er, hingerissen von der Liebe zu seinem Stoffe, nicht deuten wollen, wo eine Deutung nicht mehr möglich ist, nicht verherrlichen wollen, wo nun einmal an dem oft recht robusten Volksbrauch nichts zu verherrlichen ist. Gar zu leicht und gar zu oft haben gerade dem Volkskundler seine Phantasie und seine Begeisterung auf Kosten der Wahrheit einen Streich gespielt. Wie aber die Geschichte, so soll doch auch die Volkskunde unsere Lehrmeisterin sein, indem sie nur das wahre Wesen unseres Volkes kennen lehrt. Zur Lehrmeisterin aber kann sie nur werden, wenn man aus ihrem Buche herausliest, und nicht, wenn man in ihr Buch hineinliest, was nun einmal nicht darinsteht. Leicht freilich ist es auch um deswillen nicht, das wahre Wesen unseres Volkes aufzudecken, weil auf dem Gebiete der Volkskunde der Forscher mit Forschen und Deuten allein nicht vorwärtskommt, wenn er selbst sich schon zu weit von dem einfachen, derben Fühlen und Denken des Volkes entfernt hat. Nicht der wird das Wesen unseres Brauchtums erkennen und erfühlen können, der sich durch jahrelanges Vorgaukeln bunten Flitterkrams die Augen verdorben hat und unfähig zu natürlichem Denken und einfachem Erklären geworden ist, sondern nur der, der aus dem Volke stammend, volksnahe geblieben. Die Wahrheit, daß noch alle Zeitalter leben, geht einem niemals mehr aus als bei der Betrachtung unseres Brauchtums. Vom Glauben und Brauch der Steinzeit bis auf den Eindruck, den ein Kinobesuch oder eine Radioübertragung gemacht hat, lebt nachweisbar alles bewußt und unterbewußt im Volke und führt zu Aeußerungen aller Art. Dieses eigenartig zähe Festhalten an bestimmten Anschauungen und Lebensformen läßt sich aber nur daraus erklären, daß die Urkräfte der menschlichen Seele seit 5000 Jahren im wesentlichen dieselben geblieben sind. Aller Umbruch der Zeiten, alle Religionen und Lehren, alle Wanderungen und Verwüstungen, alle Entdeckungen und Erfindungen haben die menschliche Grundveranlagung nicht wesentlich zu beeinflussen vermocht. Nur um oberflächliche Klarheit zu gewinnen über die Ueberlagerungen und Überschneidungen, die noch heute sämtlich im Volkstum wirksam sind, treffe ich folgende Anordnung:
Die ersten und ältesten Entwicklungsstufen sind im heutigen Brauchtum deshalb noch z. T. zu erkennen, weil unser Seelenleben gewisse Urformen bewahrt hat. Von den in späteren Entwicklungsstufen ausgebildeten Bräuchen und Vorstellungen sind vor allem die in die Lebensäußerungen unseres Volkes eingegangen, welche an die Jahrtausende alten Wirtschaftsformen der Viehzucht und des Ackerbaus der Germanen geknüpft sind. Dieses Brauchtum scheint mir in seinen wesentlichen Zügen in der Bronzezeit, 2000—800 Jahre vor Christi Geburt, ausgebildet zu sein, als ein mildes und gesundes Klima die Völker Nordeuropas und der südlichen Umrandung der Nord- und Ostsee zu einer außerordentlichen Kulturhöhe auf der Grundlage von Ackerbau, Viehzucht und Schiffahrt führte. Solarische Veränderungen zwischen 1000 und 700 v. Chr. bedingten es, daß diese Kulturhöhe die folgenden tausend Jahre nicht überall beibehalten werden konnte. Durch einen Klimaumschwung gezwungen, drängten die germanischen Völker nach Süden und eroberten im schwersten Ringen mit den Kelten allmählich den ganzen heutigen deutschen Lebensraum.[1] Wanderungen und Kämpfe beeinträchtigten eine günstige Fortentwicklung; unter ihrem Einfluß wandelten sich auch die Anschauungen und die Formen des gesellschaftlichen Lebens in geringem Ausmaße nach der negativen Seite hin, die Grundhaltung des seßhaften Viehzüchters und Ackerbauers wurde aber doch im wesentlichen beibehalten, rettete sich auch durch die Stürme und Volksverluste der historisch deutlich erkennbaren Völkerwanderungen nach Christi Geburt und war danach, ständig gut unterbaut von der gleichbleibenden sozialen und wirtschaftlichen Struktur, so volksverwurzelt und kräftig, daß der Einbruch des Christentums zwar die alten Götter und Dämonen entthronen und in andere Funktionsbereiche überführen, aber nicht völlig auslöschen konnte und auch nicht auslöschen wollte. Wenn auch das Christentum manchen Volksbrauch umgebogen und seinen ursprünglichen Sinn verdunkelt hat, so hat es doch nur in geringem Maße altes Brauchtum wirklich ausgerottet. Der tatsächliche Zerfall begann erst, als die bürgerlichindividualistische Kultur alle geistigen Kräfte in bisher unmöglichem Außmaße freiwerden und sich entwickeln ließ und durch die unerhörte Ueberwindung der Natur seit dem 18. Jahrhundert der bisherigen Lebensgestaltung und Lebensanschauung die Grundlage entzog. Dadurch und u. E. allein dadurch und nicht durch das Christentum ist erst in den letzten hundert Jahren vieles alte Lebensgut verschüttet gegangen. Das liegt im Zuge der Entwicklung, man darf es deshalb nicht beklagen, sondern muß es verstehen. Darüber, daß mit dieser Feststellung „noch lange keinem wurzellosen Hinvegetieren von Augenblick zu Augenblick das Wort gesprochen sein soll“, habe ich mich schon in der Einleitung zu meinen heimatlichen Sagen geäußert. Heute, wo die Gefahren, die unseren völkischen Bestand bedrohen, klar erkannt sind, kommt es darauf an, zu scheiden zwischen dem, was über Bord gehen mußte, weil es an nunmehr überholte soziale Bedingtheiten geknüpft war, und zweitens dem, was zutiefst in unserer Wesensart ruht. Das erstere ist dahin; es wäre vergebliches Bemühen, es erneuern zu wollen; nicht naturgewachsen, sondern gemacht und verkrampft müßte es erscheinen. Das andere aber, unsere völkische, ewig aus dem Boden unserer Heimat Kraft und Nahrung empfangende Art. kann gar nicht pfleglich genug behandelt werden. Denn nur wenn ein Volk sich auf seine Eigenart und seinen Eigenwert besinnt, sie hegt und pflegt, von ihnen nimmer läßt, kann es seine ihm von Gott verliehenen Fähigkeiten entwickeln und für sich und andere nutzbar machen. Danach ist also von unserem Brauchtum noch Zweifaches lebendig und gilt es lebendig zu erhalten: Einmal das, was unserer tiefsten Naturanlage entsprossen ist. Unter dem Einfluß dieser Uranlage, die nur sehr oberflächlich durch Erziehung und Konvention abgedeckt ist, stehen wir dauernd, und also äußert sie sich auch dauernd. Vor allem fühlt sich der deutsche Mensch allezeit unter der Hand des allgewaltigen Schicksals, dessen Gewalt er anerkennt, mit dessen Gewalt er aber auch ringt; und so treffen wir immer wieder und zu jeder Zeit auf die Bräuche, die sich bittend und angstvoll fragend an das Schicksal wenden, als da sind: Furcht vor bösen Gewalten, Abwehrmittel dagegen, Wahrsagung und Glückwünschung. Dazu treten die Bräuche, die geknüpft sind an die gegenseitigen Bindungen und Abhängigkeiten der Gesellschaftsschichten sowie an die Ausbildung und Erziehung, soweit sie aus natürlichem Zwang und nicht aus sekundären Ueberlegungen resultieren. Zweitens ist das lebendig, was an die ursprünglichen Beschäftigungsformen der Germanen geknüpft ist. Seit Urzeit aber pflegt der Germane in erster Linie das Kriegswesen, die Schiffahrt und den Ackerbau und dann, in einigem Abstand, den Handel. Wo die Entwicklung im Laufe der Zeit und insbesondere im letzten Jahrhundert diese Betätigungen, z. B. das Kriegswesen, umgestaltet hat, ist an sie gebundes Brauchtum abgestorben und läßt sich nicht zu neuem Leben erwecken; soweit andererseits diese Betätigungen naturgebundene, unveränderliche Formen aufweisen, wie z. B. die Landwirtschaft, ist auch noch alter Brauch vorhanden. Aller Hantierung natürlichste Abhängigkeit aber ist durch die Abfolge der Jahreszeiten bedingt. Wenn man also das Jahr in seinem Ablauf verfolgt, wird man auch unser lebendiges Brauchtum erfassen können. Dabei ist freilich zu bedenken, daß neben manchem durchaus bewußt geübten schönen Brauch heute der tiefste Sinn unseres Brauchtums nicht mehr deutlich erkannt, oft kaum noch geahnt wird. Bei Begehung dieser in ihrer Wesenheit nicht mehr begriffenen Bräuche ist es natürlich vielfach zu willkürlichen Abänderungen, oft auch zu Vergröberungen gekommen, oder man hat die Begehung aus äußeren Gründen zeitlich gänzlich verschoben. Hier wäre zu wünschen, daß mit dem wieder Bewußtwerden altheiliger Sitte auch die rechte Form ihrer Begehung wieder Platz griffe. I. Der FrühlingskreisDie Zeit der heiligen Nächte von Weihnachten bis zum Dreikönigstage ist die Uebergangszeit vom alten zum neuen Jahre. Es ist eine besonders ausgezeichnete Zeit, voller geheimnisvollen, segenwirkenden, aber auch verderblichen Zaubers und deshalb erfüllt von Sitten, zu denen von der Steinzeit bis auf die jüngste Vergangenheit alle Zeiten beigesteuert haben. Darauf, nach der Jahreswende, folgt eine stille Zeit. Der Mensch muß sich einleben in das neue Jahr und einfühlen in die Befürchtungen und Verheißungen. Die im alten Jahre gestellten Schicksalsfragen haben, vor allem in der Silvesternacht, ihre Beantwortung gefunden. War die Frage aber auch richtig gestellt, und ist die Antwort richtig gedeutet worden? Unter diesen Zukunstsgedanken sind die Menschen ins neue Jahr eingetreten und verhalten sich wartend und still. So sind die germanischen Menschen zu allen Zeiten in den ersten Wochen des neuen Jahres gar still und in sich gekehrt gewesen. Freilich ist es im Laufe des letzten Jahrhunderts ganz besonders trübselig geworden. Das rührt daher, daß die alten fröhlichen und anheimelnden Spinnstuben nun schon seit manchem Jahrzehnt ihre Pforten geschlossen haben, seitdem Flachs nur noch wenig angebaut wird, seitdem die ausländische Wolle die heimische Schafzucht fast zum Erliegen gebracht hat und besonders seitdem der mechanische Webstuhl im Fabriksaal den Frauen und Mädchen die heimische Winterarbeit entwandte. Und die in unserer Heimat anstelle der Spinnstuben getretenen Kränzchen bieten doch nicht vollgültigen Ersatz. Aber auch die mancherlei Polizeimandate haben ihren Einfluß gehabt, daß die Zeit stiller und stiller geworden ist. Leider artete in der traurigen Zeit des 17. Jahrhunderts manches schöne alte Fest in wüste Völlerei und Rauferei aus, daß Staat und Kirche eingreifen und die verwilderten Sitten bekämpfen mußten. Doch nicht lange währt die natürliche Bänglichkeit der Erwartung, und der Fortfall des Spinnrades und die obrigkeitlichen Verfügungen können nicht hindern, daß neue Freude emporblüht. An den gesunden, natürlichen Menschen tritt die Sorge immer nur für kurze Zeit heran, dann fegt er lebenbejahend und lebensfreudig die schweren Schwaden hinfort. Und die sich allmählich dehnenden Tage und das sich allmählich reckende und streckende neue Leben geben seiner Hoffnungsfreudigkeit recht. Vom Sebastianstage (20. Januar) heißt es: „Fabian und Sebastian soll der Saft in die Bäume gahn“. Liebebedürftigen Mädchen aber, die zur Winterwende schon mehrfach das Schicksal nach dem zukünftigen Liebsten befragt haben, beginnt das Blut so zu pochen, daß sie am Tage Pauli Bekehrung (25. Januar) voll Sehnsucht nochmals die Frage stellen.[2] Bedeutungsvoller als diese Tage des stillen Januar ist der Tag der Lichtmesse (Mariae Reinigung, 2. Februar). Mit diesem Tage beginnen die Feiern, welche die Germanen seit der Bronzezeit abhalten, um das ihrige beizutragen, der langsam zunehmenden Kraft des Lichtes zum Siege zu verhelfen. Dabei ist nicht an die Verehrung eines Sonnengottes zu denken, sondern der Sonne schlechthin, von der alles Leben und Gedeihen aus der Erde abhängig ist. Von dieser altheidnischen ersten Sonnenfeier des Jahres ist nichts auf uns gekommen. Das Christentum hat sie aus dem Gedächtnis der Menschen ausgelöscht, dadurch daß es selbst eine schöne erhebende Lichtfeier an ihre Stelle setzte. Im Gotteshause wurden die Kerzen vom Priester geweiht, und dann zog die Gemeinde, Marienlieder singend, mit angezündeten Kerzen um die Kirche.[3] Doch wenn auch von dem altgermanischen Sonnenfest, von christlicher Begehung überdeckt, nichts übriggeblieben ist, so hat sich doch für diesen Tag der Lichtmesse ein Brauch erhalten, der wohl in ähnliche ferne Vergangenheit zurückführt wie die alte Sonnenfeier. In Groß-Berndten übt die Bauersfrau zuweilen noch heute den Zauber, daß sie einen Wagenreif auf den Hof legt oder auch wohl nur einen Kreis auf dem Hofe zieht und das Futter für die Hühner dort hinein streut. Dieser Brauch gibt ihr die Gewißheit, daß die Hühner das ganze Jahr hindurch in das Nest und nicht abseits ins Heu oder Gras legen. An anderen Orten gebraucht man einen ähnlichen Bann am Karfreitage. So hat sich in Lieben- rode die Sitte lange erhalten, am Karfreitage die Hühner beim Füttern mit einer langen Kette zu umgeben, um sie ein- für allemal am Weglegen zu hindern. In Rottleberode aber kennt man ein noch sichereres Mittel. Dort glaubt man, man müsse am Karfreitag vor Sonnenaufgang einen Reif auf den Hof legen, in den man dann das Futter streut und dies die Hühner fressen läßt. Wir treffen hier auf den alten Aberglauben des Bannens. Diese Kunst des Bannens schrieb man einst vielen Dämonen und Zwergen zu, ja, man glaubte bis in die jüngste Zeit hinein an die Kraft mancher Menschen, diesen Zauber üben zu können.[4] Und ein solcher Bannzauber ist auch bei mancherlei häuslicher Verrichtung nützlich. Die Bauersfrau, die das Futter in einen ganz bestimmten, abgegrenzten Raum tut, zwingt die gefütterten Tiere, die Eier an dem dafür bestimmten Platz niederzulegen. Doch kann man Lebewesen nicht nur nach den vorgesehenen Punkten hinzwingen, sondern man kann durch den Bann auch feindliche Mächte abhalten, einen bestimmten Raum zu betreten. Deshalb zog man einst, z. B. in Kehmstedt, im Frühjahr Furchen oder gar Ketten um einzelne Felder zur Abwehr böser Geister, die den Saaten schaden konnten. Ein anderer ebenfalls seit Urzeit geübter Brauch zu Lichtmeß besteht darin, daß am frühen Morgen dieses Tages die Knechte die Mägde und umgekehrt die Mägde die Knechte aus den Betten prügeln, eine Sitte, die in unserer Heimat für den dritten Weihnachtstag als „Kindeln“ bekannt ist und deshalb dort ihren Platz finden soll. Wahrscheinlich liegt aber ein Frühjahrszauber vor: Der von jugendlicher Kraft strotzende Menschenleib erhält einen Schlag mit der Lebensrute, auf daß er seinen Zweck erfülle und fruchtbar sei. Daß schließlich ein solcher Tag, an dem die Sonne sichtbarlich aufgerückt ist, für den Landmann ein Wettertag erster Ordnung ist, beweisen seine vielen Wahrsprüche: Lichtmessen können die Herrn am Tage essen. In dieser Zeit des Hornungs müssen die Urgermanen auch ein Opferfest gefeiert haben, von dem schwache Nachklänge noch bis zu uns herüber rauschen. Für den Peterstag, Petri Stuhlfeier, 22. Februar, stoßen wir nämlich auf die Sitte des Nistelns. Diese Sitte lebt noch in der Erinnerung in Groß-Berndten, Bischofferode, Kraja, Hainrode unter der Wöbelsburg, Wülfingerode, war also durch die ganze Grafschaft und die angrenzenden Bezirke hin verbreitet. In Klein-Furra wird sie noch heute geübt. Ein Bewohner beschrieb sie folgendermaßen: „Die Knaben schleichen sich in das Nachbarhaus oder zu guten Bekannten und streuen Spreu oder Häcksel in den Hausflur oder die Wohnstube; wer dabei ertappt wird, hat Prügel oder einen Guß kalten Wassers zu gewärtigen.“ Auch im benachbarten Rüxleben, in Oberdorf und in Rehungen findet das Nisteln noch hin und wieder statt. Doch hat sich die Sitte zuweilen recht verfeinert, indem man statt der häßlichen Spreu auch wohl Blumen in die Stube wirft. Eine Erklärung für diese eigenartige Sitte des Nistelns wird kaum versucht. Fr. Schmidt weist sie für den Kreis Sangerhausen nicht für den Peterstag, sondern für Matthias (24. Februar) nach. Er erklärt nisteln als nüsseln, d. h. prügeln, weil sich an diesem Tage die Jugend die Köpfe mit Flachsknoten bearbeitete.[5]  Diese Erklärung stößt aber schon sprachlich aus Schwierigkeiten, denn aus einem ursprünglich vorliegenden Nüsseln kann, da die Sprache immer mehr verschleist, nicht das differenzierte Riffeln werden, das allenthalben allein bezeugt ist. Tatsächlich ist nisteln gleich nisten mit einer l-Ableitung und entspricht dem englischen to nestle. Am Peterstage machte die Bauersfrau nämlich den Hühnern die Neste, nistelte also. Dieser Ausdruck wurde dann von der Tätigkeit der Hausfrau auf den Schabernack der Dorfjugend, der an demselben Tage stattfindet und auch in ursächlichem Zusammenhang mit dem Nestbauen steht, übertragen. Die Knaben sangen nämlich einst beim Nisteln: Nistel, Nistel bunt Ei; Diese Bitte um eine Gabe am Peterstage muß man zusammenbringen mit dem für diesen Tag bezeugten heidnischen Brauch, den Toten Opfer darzubringen. Das Konzil von Tour verbot im Jahre 567 diese Seelenopfer. Wir haben es also ursprünglich mit einer Opferung zu tun, die den Toten, den Unfruchtbaren dargebracht wurde, um sie zu versöhnen und zu veranlassen, dem neu Heranwachsenden, fruchtverheißenden Leben gnädig zu sein. Wahrscheinlich wurde in Urzeiten den Toten an diesem Tage ein Menschenopfer dargebracht und zwar ein junges Menschenkind. Später traten Speiseopfer an die Stelle des Blutopfers. Die Kinder aber, von denen eines den Toten zum Opfer gefallen war, wurden zu Ostern beschenkt, wenn tatsächlich das Opfer genützt hatte und ein reicher Segen an fruchtträchtigen Eiern eingetreten war. Den Opferbrauch für die den Menschen gefährlich werdenden Toten, die man sich in substantieller Form, nicht als Seelen weiterwirkend dachte, muß man bis in praeanimistische Zeiten, bis in die jüngere Steinzeit zurückverlegen. Mit diesem Brauch, der im Nistelverse nur noch ganz verschollen anklingt, hat sich m. E. nun im heutigen Nisteln ein zweiter, viel jüngerer Brauch verwoben, auf den das Häckselstreuen und Beschmutzen der Stuben hinweist. Es ist eine Verspottung der Hausfrau, die Nester baut und auf den Frühling hofft; aber der Winter mit seinem Schmutz und abtauenden Schnee ist noch da, er macht sich noch recht unangenehm bemerkbar. Das wird der Hausfrau zu Gemüte geführt, die sich freilich mit einem Kübel Wasser gegen den Schmutz und die ihn verbreitenden Knaben zur Wehr setzt.[6] Mit des Winters Schmutz und Unsauberkeit hängt auch ein anderer am Peterstage nicht mehr bei uns, aber sonst im deutschen Vaterlande geübter Brauch zusammen. An diesem Tage muß man bei Sonnenausgang mit einem Hammer an die Eckpfosten des Hauses und der Ställe klopfen. Dadurch werden Larven, Ratten, Mäuse und jegliches Ungeziefer vertrieben, und das Vieh bleibt gesund. Dieselbe Vorstellung liegt der Sitte zugrunde, die aus Elende bezeugt ist, daß man am Karfreitag dreimal mit dem Dreschflegel um die Scheune herumdreschen müsse, damit keine Mäuse hineinkommen. Man glaubt, daß tückische Dämonen und Teufel in garstige niedere Tiere eingehen, die sich zur Winterszeit in die Ecken und Winkel der Häuser eingenistet haben und nun mit dem kommenden Frühling gewissermaßen durch einen Reinigungszauber vertrieben werden sollen. Wie ja auch Goethe weiß, daß der Teufel der Herr des Ungeziefers ist, wenn er Mephistopheles sagen läßt: Der Herr der Ratten und der Mäuse, So wird man denn am Peterstage das wertlose Winterungeziefer los; aber auch von dem Wertvollen, was man in Kammer und Küche aufgespeichert hat und was übriggeblieben ist, trennt man sich nun gern und füllt die Vorratsräume mit frischer Ware auf. Die alten schon etwas abgelagerten guten Dinge mögen die Gemeindebeamten, insbesondere mag sie der arme Schulmeister bekommen, und so war der Peterstag auch der Tag, an dem die Kinder ihren Lehrern Erbsen, Bohnen, Aepfel, Speck, Wurst, Eier, Flachs darbrachten und danach ein Schulfest mit ihm begingen.[7] Nun aber, mit dem Ende des Schmutzmonats, des Februars,[8] rüstet sich alle Welt, den Frühling festlich zu empfangen. Schon wagen Burschen und Mädchen sonntags einen Spaziergang in den Buchenwald und sind erfreut, wenn ihnen aus den bisher toten Farben die feltsam purpurn leuchtende, stark duftende kleine Blüte des Seidelbastes oder besser Zeidelbastes entgegenprangt. Das Erblühen des Zeidelbastes, der Blume, die dem urgermanischen Himmelsgotte Tiwas, Ziu heilig war,[9] kündet die Zeit an, da der Himmelsgott sich ausmacht, sich der Erdmutter zu nähern, auf daß aus ihrer Umarmung alles Leben neu erweckt werde. Eine solche Zeit regt zu neuer Schaffenslust und neuer Hoffnung an und die Hoffnung zu übermütigem Tun. Wenn die Ströme ihrer Bande freiwerden, wenn man mit der Küstenschiffahrt wieder beginnen kann, wenn der Landmann seine Arbeit im Freien aufnehmen und der Meister daheim ohne künstliches Licht eine Stunde länger werken kann, dann hat man bei all' dem neuen frohen Treiben nach der Dunkelheit und Untätigkeit des Winters wohl Grund, ausgelassen und beinah toll zu sein. Dann muß man faseln, Unsinn begehen, die Fasenacht feiern.[10] Mit diesem Feste begeht man noch heute eine Kultfeier, die bis auf die Bronzezeit zurückreicht und ihren Ursprung hat in der Verehrung der heiteren und friedlichen Götter der Schiffahrt und des Ackerbaus, offenbar eines Kultus, welcher der Vorgänger der Wanenreligion, der Verehrung des Freyr und Nerthus durch die späteren ingväonischen Germanen ist, im Gegensatz zu der dann aufkommenden Verehrung Wotans oder Odins und seines Kreises, dem Asenkult, der kriegerischer und heroischer ist. Auch diese Fastnacht ist gedeutet worden als alte Totenfeier, bei der nach Darbringung des Opfers wacker geschmaust und gezecht wurde, um die Toten zu ehren und um durch die Verspeisung der Opferreste selbst an der Segnung durch das Opfer teilzuhaben. Gebäcke, deren Anfertigung an diesem Tage gebräuchlich ist, scheinen, so meint man, späte Nachbildungen des einstigen blutigen Opfers zu sein. So wurden z. B. in Sangerhausen von Fastnacht bis Ostern Brezeln gebacken und zwar nach Innungsvorschrift jedesmal nur von einem Bäcker.[11] Doch der ganze übermütige Charakter der Fasenacht, der nicht erst mittelalterlich oder nemeitlich, sondern uralt ist, dazu manche andere sinnvolle Ausgestaltung des Festes weisen nicht auf ein Totenfest hin, sondern auf ein Fest, bei dem der abziehende Winter verspottet und der Einzug des Frühlings gefeiert wird. Wahrscheinlich sind dabei auf das Fasefest verschiedene Bräuche anderer Frühlingsfeste, die einstmals etwas später im Jahre begangen wurden, übertragen worden. Ueberhaupt liegt ein bestimmter Brauch selten für eine Begehung allein fest, sondern meist wiederholt er sich in derselben Jahreszeit, manchmal sogar durch das ganze Jahr hin des öfteren. Im wesentlichen sind in der heutigen Fastnacht zwei ursprüngliche Feiern zusammengeflossen: erstens die Umfahrt der Fruchtbarkeitsgottheiten, insbesondere des zwiegeschlechtlichen Nerthus. Auf einem Wagen hielt die Gottheit feierlichen Umzug durch die Lande, segnete sie, und überall wurde die Erdmutter fröhlich empfangen und verehrt. Zweitens aber deutet noch heutiger Brauch bei der Fastnachtfeier auf ein altes Schiffsfest hin. Bronzezeitliche Felszeichnungen in Schweden, die der Schwede Almgren richtig erklärt hat, zeigen Schiffe ohne Segel und Ruder, auf denen das Sonnenzeichen angebracht ist, in denen betende Menschen stehen und die feierlich über Land gezogen werden. Wir haben es also mit einem Feste zu tun, bei dem nach gebrochener Winterkraft die Schiffe wieder ins Wasser gezogen werden. Noch frühneuzeitlicher Brauch beweist, daß tatsächlich der Beginn der Schiffahrt festlich begangen wurde. Halten doch die Weber vom Niederrhein das Recht, im Frühling im festlichen Zuge die ersten Schiffe ins Meer hinunterzuziehen, damit sie neue Wolle aus England Hollen. Vor allem aber beweist die Ausstattung des Festes bei südeuropäischen Völkern seinen Sinn. Wenn nach den Stürmen des Winters die Nachen wieder zu Wasser gelassen werden können, begeht man ein ausgelassenes Fest, in dessen Mittelpunkt ein Wagen mit der Nachbildung eines Schiffes, der carrus navalis, der Karneval, steht. Um noch etwa Widerstand leistende Winterdämonen zu vertreiben, laufen vor dem Festzuge die Pritschenmänner her, die mit ihren Pritschen und Peitschen um sich schlagen und knallen, um die Wintergeister vollends zu verscheuchen. Die Verkleidung aller Art und die Masken sollen ursprünglich gegen die bösen Geister unkenntlich machen. Demselben Zwecke dient das zuweilen geübte übermütige Schwärzen der Mädchen, die dadurch entstellt und von den Dämonen nicht erkannt werden. Dieser Brauch des Schwärzens wird mehrfach, auch bei anderen Festen begangen, so z. B. in unserer Heimat in Urbach zu Ostern, wo man die Mädchen heute nur noch zum Schabernack schwärzt, oder zu Walpurgis, um sie für die zum Brocken fahrenden Hexen unkenntlich zu machen, oder zur Kirmeß durch den Erbsbär. Daß auch in unserer Heimat der Aberglaube verbreitet ist, die Begegnung des schwarzen Mannes, des Schornsteinfegers, sei glückbringend, ist auf dieselbe Meinung zurückzuführen.[12] Die Vertreibung des Winters, der Einzug des Frühlings hat auch zu dramatischen Spielen an diesem Tage Anlaß gegeben. Teilnehmer am Festzuge führen mit verteilten Rollen einen Weltkampf zwischen Winter und Frühling auf, bei denen es nicht bloß zu derben und drastischen Prügelszenen kommt, sondern zu mindestens ebenso drastischen Wortgefechten. Da ist dann der gewiesene Ort, in diese heiteren Plänkeleien auch manche Anspielung auf alle Geschehnisse des Jahres und die daran beteiligten Menschen einzufügen. In unserer Heimat, wo schon in alter Zeit die Fasenacht gegenüber anderen Frühlingsfesten zurücktrat und nie fo ausgestattet war, übt man diese Satire zur Kirmeß. Jedenfalls ist ein derartiges Rüge- und Narrenspiel in den seit alters von rein deutscher Bevölkerung besiedelten Gebieten überall gebräuchlich und beweist, daß zu allen Zeiten die Germanen genug Offenheit und genug Humor besessen haben, ebenso freimütig Kritik zu üben wie sie sich gefallen zu lassen.[13] Aus dem Narrentreiben und dem Rügespiel haben sich dann seit dem 14. Jahrhundert die Fastnachtspiele entwickelt. Eine niederere Form der Neckerei ist auch in unserer Heimat zur Fastnacht, ähnlich wie die vom 1. April, bekannt, wenn man Kinder zum Kaufmann schickt und sie unmögliche Waren, etwa Zwirnsamen u. dergl., holen läßt, und dieser ihnen Steine in den Korb packt. Der eigentliche Sinn des Fasefestes ist bei uns sehr früh untergegangen. Deshalb haben wir dafür auch nur geringe Belege. In der Goldenen Aue fanden einst Umzüge mit Verkleidungen und Narrenpossen statt; der Brauch ist längst vergessen. Erhalten hat sich in einigen Orten der Erbsbär zur Fastnacht, der aber im allgemeinen auf die Herbstzeit verlegt ist. Deshalb soll vom Umzug des Erbsbären auch später gesprochen werden. Tatsächlich gehört der Erbsbär aber ins Frühjahr, und wenn er noch in Stempeda im Osten, in Tettenborn im Westen und in Badra im fernsten Südosten unseres Gebietes zur Fastnacht auftritt, so ist das ein Beweis dafür, daß er einstmals in unserer ganzen Heimat bei beginnendem Frühjahr bekannt war. Offenbar ist in dem Auftreten des Bären nur der eine Teil des Fastnachtsspieles übriggeblieben, nämlich die Verhöhnung des Winters, während man den Einzug des Frühlings später feiert und ihn mit anderen Festen in Verbindung gebracht hat. In Badra heißt es noch heute: Der Bär soll den Winter darstellen.[14] In Windehausen beging man einst zu Fastnacht unter ähnlichen Formen das Wildemannsfest, bei dem der wilde Mann auch nichts weiter als der Winter war.[15] Sonst war es in unserer Gegend noch üblich, zur Fasenacht sich an Schmausereien gütlich zu tun. Am Sonntag und Montag vor dem Feste war Tanz, dann sammelte man im Laufe des Dienstags Gaben ein und verzehrte sie am Dienstagabend. Das Fest wurde besonders gern in den Spinnstuben gefeiert. In Groß-Berndten war man einst so üppig, gar acht Tage zu feiern. Auch in Nordhausen muß es in früheren Zeiten reichlich ausgelassen hergegangen sein, wie die vielen Ratsmandate, z. B. aus den Jahren 1669, 1678, 1695 beweisen. In einer solchen Ratsverordnung heißt es: „… befehlen wir …, daß sich niemand, er sei, wer er wolle, Bürger, Bürgerkind oder Fremder, des Fastnachtlaufens und -Haltens gelüsten lasten noch sich dessen unterfangen, viel weniger einige unserer Bürger für sich oder unter dem Schein des Bierschenkens solche üppigen Fastnachtsgesellen und ihre Anhänger aufnehmen, Hausen noch dulden solle.“ Besonders Handwerksburschen und Ackerknechte sollen ihre Zusammenkünfte unterlassen und das dabei entstehende „Tumultieren, Schlagen und Raufen.“ Doch auch ernsthafte Stücke wurden an diesem Tage von den Schülern des Nordhäuser Gymnasiums aufgeführt. Mit am längsten hielt sich die Feier am Harzrande, z. B. in Ilfeld und in Dietersdorf, wo man Kuchen und Kräpfel buk, Kaffee, Schokolade und Punsch trank und ein Tanzvergnügen veranstaltete. Und der letzte Rest des einstigen Heischens von Gaben, die man dann am Abend verschlemmte, ist noch übriggeblieben in dem Umzug von Kindern zur Fastnacht. Da singen sie dann, um sich Geld zu erbetteln, das bekannte Lied, das noch mehrfach im Jahre wiedertönt, besonders zu Neujahr: Rosen rot, Rosen rot, Heute ist die Erinnerung an alten Fastnachtsbrauch nur noch in Steigerthal lebendig, wo vom Fastnachtsdienstag über den Aschermittwoch hinfort bis zum Donnerstag hin wacker geschmaust und oft auch noch am folgenden Montag gefeiert wird. Natürlich hat diese Art der Festbegehung allein durch Tanz und Schmauserei keinerlei Anklang an alte heidnische Bräuche bewahrt, sondern ist nur der Abschied von den gewohnten Mahlzeiten und die Vorbereitung aus die christlich-kirchliche Fastenzeit. Neben dem Gabenheischen für den Festabend steht in unserer Gegend noch der ernsthaftere Brauch einzelner Handwerke, zu Fastnacht die ausstehenden Forderungen einzutreiben oder sich einen Sonderlohn zu erbitten. Die Schmiede, die Böttcher und Stellmacher, die während des Winters die Gerätschaften für den Landmann haben ausbessern müssen, sind an diesem Tage unterwegs, um den Dank für ihre Arbeit einzufordern. Dazu gesellen sich in manchen Orten noch die Müller und Schäfer. In Haferungen, Nohra, Ilfeld, Sülzhayn, Uthleben u. a. Ortschaften ist es noch heute üblich, daß die Handwerker, vor allem die Schmiede, zu Fastnacht, oder, wie in Sülzhayn und Rottleberode, am Donnerstag vor der Fastnacht herumziehen. Noch bis vor wenigen Jahren sagten sie dabei folgende Verse auf: Jetzt kommt der Schmied geschritten. Nach Empfang der Wurst trat der Schmied ab mit den Worten: So will ich mich bedanken. Nun, nach dem Umzug der Fruchtbarkeitsgottheiten drängt alles zum Wachstum. Und der natürliche, unverbildete Mensch wird erfüllt von jauchzender Fröhlichkeit beim Betrachten des frischen Sprießens und Blühens und Befruchtens, das ihn rings umgibt. Ihn ergreift die Seligkeit, die der Anblick hoffnungsfroher junger Keimlinge gewährt, die allem zum Tode verdammten irdischen Leben ein Pfand für ewiges Dasein sind. An diesem Keimen und Aufgehen und Heranwachsen bei aller Natur, auch beim Menschen Anteil zu nehmen, es hilfsbereit zu fördern, ihm den Anreiz zu geben, daß es gerade wachse und nicht verderbe, muß das Bestreben der ganzen menschlichen Gemeinschaft sein. Wie man am Emporquillen der Saaten, am Emporsprießen der Gräser schon aus rein materiellen Gründen seine Freude hat, so auch an der ordnungsgemäßen Vermehrung des Viehbestandes. Der Gemeindebulle ist ein durchaus nützliches Tier für die Aufzucht der Rinder und die Wohlhabenheit der Bevölkerung. Kein Wunder, wenn die ganze Dorfschaft ein Interesse an dem Wohlbefinden dieses Tieres hat und seine Tüchtigkeit feiert. Bis über die Mitte vorigen Jahrhunderts hinaus stattete Klein-Bodungen seine sogenannte Ochsenhochzeit zu einem übermütigen Feste aus. Am Montag nach Invocavit schmückten frühmorgens die Mägde den Bullen mit grünem Gerank und Blumenkränzen und ließen dann das geschmückte Tier durch den Ort führen. Vor der Gemeindeschenke erhielt der Führer einen Imbiß, während der Bulle vor dem Gasthause stand zur allgemeinen Bewunderung. Dann kam das Tier wieder in den Stall. Am Abend aber fand „das Hochzeitsfest“ statt, bei dem der Bauer, der in diesem Jahre die Unterhaltungspflicht für den Bullen hatte, eine Tonne Bier zum besten geben mußte. Aber auch der Heranwachsenden Menschlein, der kleinen und der größeren, gedenkt man im Frühjahr und nimmt teil an ihrer Freude und an ihrem Stolz, wenn sie wieder einmal bei ihrer Entwicklung eine Stuse emporgestiegen sind. Dann muß man sie auch beschenken oder ourch feinere ooer aoer meist gröbere Späße anregen, sich dem neuen Grade, den sie nun erklommen haben, würdig zu erweisen. Seit alten Zeiten schon wird die Beendigung des alten und der Beginn des neuen Schuljahres als Freudenfest begangen. Die Kleinen, die neu eingeschult werden, erhalten die bunte Tute. Die Größeren feierten einst am 12. März das ausgelassene Gregorsfest. Dieses Fest ist nach dem Papste Gregor IV., einem Kinderfreunde, genannt, der das Schulfest 830 gestiftet hat. Für die Nordhäuser Gelehrtenschule können wir es bis zur Reformationszeit zurückverfolgen, es ist aber wahrscheinlich schon im Mittelalter begangen worden. Abgesehen davon, daß die Kleinen an diesem Tage in die Schule ausgenommen und mit süßem Backwerk beschenkt wurden, war es für groß und klein so recht ein Fest aus dem Uebermut und der Spottsucht der Germanen heraus, an der sich selbst in gebundener Gemeinschaftskultur der zum Individualismus neigende Charakter unserer Vorfahren erkennen läßt. Um die Schülerlein zu fördern und an diesem Tage ja keine Scheu vor Rang und Stand, Alter und Würde aufkommen zu lassen, galten, ähnlich wie bei den Exkneipen der Studenten, gewissermaßen „umgekehrte Semester“. Die Schüler waren die Herren, die Lehrer und Pfarrer mußten gehorchen. Zu ausgelassenem Zuge trat die ganze Schülerschaft mit einem als Bischof verkleideten älteren Schüler an der Spitze an. Dieser schritt unter einem Baldachin daher, den Lehrer und Diakone tragen mußten, bis zur Nikolaikirche. Hier, in der Kirche hielt der „Bischof“ eine witzige, mit Anzapfungen von Lehrern und Standespersonen gespickte Rede. Das Fest endete mit einer gemeinsamen stattlichen Mahlzeit aller älteren Schüler.[17] Am Abend fanden sich dann die vornehmen Kreise der Stadt Nordhausen mit den Pfarrern und Lehrern zu einem recht üppigen und wiederum Redefreiheit in weitestem Maße gewährenden „Convivium scholasticum“ zusammen. Hierbei war so ziemlich alles gestattet, und der jüngste Kollege durfte seinen Rektor, den Pastor primarius als Inspektor der Schule oder gar die Herrn Bürgermeister zausen. Auch diesem schönen, der Spottlust der Germanen so genehmen Feste machte die Verwilderung der Sitten nach dem Dreißigjährigen Kriege den Garaus. Es wurde in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts in Nordhausen „propter excessus“ verboten.[18] Doch nicht nur die Schuljugend hält im Frühjahr Rückblick über die verflossene Zeit und Ausblick dahin, wo das Leben winkt, sondern auch die Lehrbuben werden in die Lehre ausgenommen, die Gesellen machen ihr Gesellenstück und werden zu Meistern erklärt, das alles unter mancherlei Zeremonien und nicht ohne wackeren Umtrunk. Auch die Heeresmusterungen wurden vereinst im Frühjahr aus dem Märzfelde oder Maisfelde abgehalten. Und bei allem fanden Prüfungen statt, welche den Stand der Tüchtigkeit oder die Reife feststellen sollten. Nebenher gehen die Prüfungen, welche die Jugend seit uralten Zeiten über ihresgleichen selbst abnimmt, um die Bewährung zu erproben. Der aus der Dorfschule entlassene Knabe wird von den Burschen, den Bengeln, wie sie in unserer Heimat heißen, noch nicht für voll genommen. Aber ein Jahr nach der Entlassung kann man einmal nachschauen, ob er zu einem tüchtigen „Bengel“ herangewachsen ist. Zur Ueberprüsung seiner Tauglichkeit wird er in Nohra und anderwärts in einen Kübel Wasser getaucht, und danach muß er den Burscheneid ablegen. So wird er „gedengelt“. Ganz allgemein dient jeder Wassersegen zur Förderung der Entwicklung und Tüchtigmachung. So ist es auch mit dem Wasserbad, das den Konsirmanden von Klein-Furra und Rüxleben zuteil wird. Die Schüler und Schülerinnen müssen nämlich hier zwei Jahre in die Konfirmandenstunde gehen, und der jedesmal ältere Jahrgang treibt den neu hinzugekommenen durch den Dorfbach. Damit hat man dann die Gewähr für seine Tüchtigkeit und Zünftigkeit. Jeder unverbildete, naturhafte Mensch fühlt sich als ein Stück Natur, er bildet mit der ganzen Natur, ob Stein, ob Strauch, ob Pflanze, ob Tier eine harmonische Einheit. Erst spätere Religionen und philosophische Systeme nehmen die Trennung von Körper und Geist, Sinn und Seele nicht nur als sprachlichdialektischen Notbehelf an, sondern als unumstößliche Wahrheit. Die Natur und der naturverwurzelte Mensch kennt solchen Unterschied nicht, Körper und Seele, Mensch und Natur sind ihm eins, und so weiß er sich auch jedem Wesen verwandt. Daher meint auch der Mensch, daß die Kräfte der Natur, der Pflanze, des Tieres in ihn eingehen, wenn er, Fleisch von ihrem Fleische, sie genießt. Mit den Frühlingsfesten war einstmals deshalb auch der Genuß von frisch sprossenden Pflanzen allgemein verbunden. Vor noch nicht garzu langer Zeit mußte der in Elende jährlich unter Freudengejauchze eingeholte Frühlingsprinz ihm feierlich überreichte Weidenkätzchen oder Knospen verzehren: Die Erstlinge des Frühlings dem Frühlingsgotte, sie beide sind eins. Und für den Grünen Donnerstag hat ja allenthalben das deutsche Vaterland diese Sitte beibehalten. Es liegt hierbei ein durchaus heidnisches Brauchtum der germanischen Zeit zugrunde, in der neben die Wanengötter schon die Äsen getreten waren. Der Donnerstag ist dem westgermanischen Donar, dem nordgermanischen Thor geweiht, dem asischen Fruchtbarkeitsgotte.[19] Ihm zu Ehren ißt man am Gründonnerstage alles, was er mit dem Einzüge des Frühlings beschert hat: Salat, Spinat, Blaukohl, Rapunzel, Lauchsalat, Petersilie, Grünkohl von Blättern des Raps (früher in Hainrode), dazu am besten frisch gelegte Eier. Wie stark das Bewußtsein an dem einst dem Donnergotte geweihten Tage noch vorhanden ist, sieht man daran, daß bis vor kurzem in Mörbach der Glaube lebendig war, daß man am Gründonnerstag gelegte Eier aufheben müsse, weil sie gegen den Zorn Donars, gegen Blitzschlag schützten. Auch der Glaube, wer am Gründonnerstag grünen Salat esse, den würden das ganze Jahr hindurch die Fliegen, Flöhe, Mücken nicht stechen, hat seine Bedeutung (Oberdorf, Rehungen). Das Ungeziefer meidet Gesundes, sich kräftig Entwickelndes und sich gesund Ernährendes. Mit einem bloßen Aberglauben dagegen hat man es wohl zu tun, wenn überall in unserer Heimat die Meinung verbreitet ist, daß die am Gründonnerstag gelegten Eier bunte Küchlein ergäben, die jährlich ihre Farbe wechselten. Ebenso beruht auf mittelalterlichem Wahn, man könne die Zukunft weissagen, wenn man das Eiweiß eines am Gründonnerstage gelegten Eies in ein halb mit Wasser gefülltes Glas schlage, oder man könne Hexen erkennen, wenn man ein solches Ei mit in die Kirche nehme. Die christliche Kirche hat sich die Gesamthaltung der Bevölkerung und ihre Freude an frischem Grün jeder Art zunutze gemacht und feiert deshalb das Palmenfest. Zu Palmarum weiht der Priester Palmzweige in Erinnerung an Jesu Einzug in Jerusalem, und die protestantische Kirche hat in rechter Wertung uralter Bräuche auf diesen Tag die Einsegnung der Konfirmanden gelegt, bei denen es noch heute in vielen unserer Dörfer üblich ist, daß der Knabe einen von seiner Konfirmandin geschenkten Strautz angesteckt trägt und das Mädchen ein ihr von ihrem Partner verehrtes Kränzlein auf dem Haupte.[20]  Weniger verwurzelt mit völkischem Denken als mit dem erhabensten Gedankengut der christlichen Kirche ist der Karfreitag.[21] Mit diesen letzten Feiern, Psalmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag sind wir in den Bezirk der christlichen Ostern getreten. […] Wir finden beim Osterfeste in klarster Ausprägung den Gedanken eines Sonnenkults zur Zeit der Frühjahrs-Tag- und Nachtgleichen. Ebenso kehrt, wie bei anderen Frühlingsfesten, die Freude wieder am Wachstum und Gedeihen aller Lebewesen im Frühjahr und damit der Wunsch, bei dieser Entwicklung nachzuhelfen, aber auch der Wunsch, Leistung und Fortschritt des Heranblühenden zu überwachen und zu überprüfen. Diese Verehrung der Sonne und die Ausübung von Fruchtbar- keitszauber beruhen sicher auf bronzezeitlichem Glauben, gruppieren sich später um den Wanengott Freyr oder den ihm nahestehenden Äsen Donar und haben seit mehr als 3000 Jahren alle Zeiten überdauert.[22] Jünger, wenigstens in seiner Ausgestaltung, wird der dritte Kreis der Osterbegehung sein, der sich um den Gedanken des Sieges und der Verehrung der Frühlingsgottheit schmiegt. Sicher findet sich hier in der Vorstellung der Flucht der Winterdämonen vor den lichten Frühlingswesen auch urindogermanisches Kultgut, aber über dem Geisterglauben erhebt sich doch schon ein Glaube an eine persönlich gedachte Gottheit, die idealisierte menschliche Züge trägt, unsterblich ist und ihren Sitz außerhalb dieser Erde hat, auf die sie nur zu Zeiten niedersteigt. Dieser Glaube an einen persönlichen Gott ist nachbronzezeitlich. Mögen die einzelnen Vorstellungen und Begehungen aber älteren oder jüngeren Datums sein, — soweit sie heidnisch sind, sind sie alle aufs engste an die Natur geknüpft. Das religiöse Gefühl der Germanen ist durchaus identisch mit der Freude über die Schönheit, mit der Demut vor der Erhabenheit, mit dem Erschauern vor der Allmacht der Natur. Wo nun die Verbundenheit mit der Natur erhalten geblieben ist, da finden wir bis auf den heutigen Tag auch diese Naturreligion erhalten, bei den Hauptfesten sogar so stark erhalten, daß das alte Brauchtum durch alle neueren Überlagerungen und Entstellungen hindurchleuchtet. Beim Osterfeste ist das in dem Maße der Fall, daß die christliche Religion dem Feste keinen christlichen Namen gegeben, sondern den ursprünglichen, heidnischen übernommen hat. Das alte Brauchtum war so fest im Charakter der Germanen verankert und lag so fest begründet in ihrer wesentlichen Hantierung, dem Ackerbau und der Viehzucht, daß an ein Ausmerzen des Festes gar nicht zu denken war. Aber auch alle Vorstellungen, die mit diesem Frühlingsfeste verbunden waren, kamen den christlichen Anschauungen derart entgegen, daß die Kirche keine weitgehende Umgestaltung nötig hatte. Der Auferstehungsglaube der germanischen Naturreligion und der christlichen Heilslehre lösen in dem Menschen ganz ähnliche Gefühlsreaktionen aus und damit auch Feierlichkeiten, in denen diese Gefühle ihren Ausdruck finden können. Nur der Erlösungsglaube ist bei den Germanen in der vom Christentum ausgebildeten Form nicht vorhanden. So finden wir denn im Osterfeste ähnlich wie beim Weihnachtsfeste friedlich nebeneinander heidnische und christliche Anschauungen. Der Name Ostern ist urgermanisch und sicher urverwandt mit Osten. Ostern ist zunächst das Fest des im Osten aufgehenden Tagesgestirns. Die spätere Personifikation schuf dann eine Lichtgöttin Austro, Ostara, ein Name, der freilich nirgends bezeugt ist, aber angenommen werden muß für die zu Ostern verehrte Gottheit.[23] Bei den einzelnen Feierlichkeiten des Osterfestes können wir für unser heimatliches Brauchtum keine Opferungen, am allerwenigsten Menschenopfer nachweisen. Wo Andeutungen vorhanden sind, scheinen sie jüdisch-christlicher Natur zu sein und aus dem Erlösungsglauben dieses Kreises zu stammen. Der jüdische Gott befahl dem Abraham, seinen Sohn zu opfern, um ihn zu prüfen. Die Juden auferlegten dem Sündenbock ihre Sünden und opferten ihn. Die Nordgermanen nahmen zu Upsala große Opferungen vor, doch sind diese für die Westgermanen nicht nachweisbar. Dagegen finden wir überall die Feier des Auferstehungswunders. Das Symbol dafür ist das Ei, der Keim aller Dinge. Wunderbar wirkt und wächst das verborgene Leben im Ei, in der Aehre, in jedem Keim und Korn. Das verborgene Leben im Ei nehmen die Dinge an, mit denen man das Ei in Berührung bringt. Deshalb legte man früher Eier in den Acker, um ihn fruchtbar zu machen. Später ward es Brauch, sie wiederzusuchen und herauszunehmen, wenn man glaubte, sie hätten ihre Aufgabe erfüllt. Die Sitte des Ostereiersuchens der Kinder stammt daher. Das Ei ist der Kirche auch das tiefe Sinnbild des Erlösers, der aus dem Grabe erstanden. Eine sehr fröhliche und liebliche Naturphantasie unserer Vorfahren aber ist die Fabelei, der Osterhase habe die Eier gelegt. Im kurzen Gras und Halm sieht man zu Ostern die alten Hasen die Ohren spitzen, sehr stolz und würdig, da sie ihren Pflichten pünktlich nachgekommen sind, wie man an den vielen jungen Häslein sieht, die sie umhüpfen. Wie in weiten Gegenden Deutschlands, besonders in denen, die von den Sachsen beeinflußt sind, noch heute die Osterfeuer am ersten Osterfeiertagabend emporflammen, so auch in unserer Heimat. Wir feiern durch die Feuer auf den Bergen die Frühjahrs-Tag- und Nachtgleiche, dagegen nicht die Sommersonnenwende. Südlich von uns, wo kein sächsischer Einfluß vorhanden ist, werden die Johannisfeuer entzündet, die wir ursprünglich nicht kennen, die wahrscheinlich nicht germanischer Brauch sind und die bei uns hie und da erst in den letzten Jahren, ohne daß irgendein Grund dafür vorläge, angezündet werden.[24] Nach unserer Meinung sind die Osterfeuer ursprünglich nichts weiter als die Nachahmung des Tagesgestirns. Die Sonne bringt alles Heil, das Feuer als Sonnensymbol ist ein Heilszeichen. Der Name Ostern deutet darauf hin und auch der bei uns weit verbreitete Glaube, zu Ostern hüpfe die Sonne beim Aufgang, oder, wie man wohl auch fagt, sie mache drei Sprünge. Da es ferner in der Tat ursprünglich nur um die Verehrung des Gestirns geht, erweist auch der Brauch, da man sich beim Gebete zunächst nach Osten wandte und dann dem Laufe der Sonne nach auch in die Richtungen der anderen Himmelsgegenden. Das Osterfeuer soll durch seinen Glanz der Sonne den Dank der Menschen entgegenschicken, weil sie nunmehr ein ganzes halbes Jahr lang mehr als 12 Stunden über dem Horizont bleibt, und es soll sie „anfeuern“, ihre Strahlen ja recht brav und barmherzig herniederzusenden. Insofern kann man wohl die Feuer als eine Darstellung der Verbindung zwischen göttlicher und irdischer Welt betrachten, darf dabei aber nicht an Geistiges denken, sondern an durchaus Substantielles. Aus der Vorstellung der Sonne und des Feuers erwuchs dann auch der Glaube an die reinigende und läuternde Kraft der Flammen. Viel geschrieben ist im Hinblick hierauf über die sogenannten Notfeuer oder wilden Feuer, die man entfachte, wenn eine Seuche die Viehherden befiel und sie zu vernichten drohte. Der Glaube, da das Notfeuer den Tieren, die durch die Flammen getrieben werden, nur dann nütze, wenn es nicht durch Stahl, Stein oder Schwefel hervorgebracht würde, sondern durch das Drehen des harten Quirlstabes im weichen Holze, erweist den Brauch allerdings als uralt. Ein Notfeuer, das 1842 in Gerterode wegen einer bösartigen Klauenseuche angezündet worden war, beschreibt der Heiligenstädter Heimatforscher Waldmann eingehend.[25] In Oberdorf und in Rehungen haben sich längste Zeit Erinnerungen an einst entfachte Notfeuer gehalten. Bis auf den heutigen Tag steht die Inbrandsetzung des Osterholzstoßes im Mittelpunkte des Osterfestes. Schon wochenlang vorher wird Reisig für den Holzstoß herbeigeschafft; jede Dorfschaft setzt ihre Ehre darein, recht viel Feuerungsmaterial zusammenzubekommen. Naheaneinanderliegende Ortschaften, die miteinander rivalisieren, suchen sich auch wohl gegenseitig Holz vom Holzstoß zu entwenden. Deshalb muß er bewacht werden, wie es z. B. in Kelbra zuweilen geschieht, wo die Bewohner des eigentlichen Kelbra und des Altendorfs, natürlich die jugendlichen Bewohner mit besonderer Leidenschaft, ihre Rechte und ihr Eigentum eifersüchtig voreinander behüten. Am Nachmittage des ersten Ostertages ziehen dann beinah in allen unseren Dörfern die jungen Burschen, noch einmal besonders lebhaft heischend, durch die Straßen: Wellen rus, Oder nicht ganz so heftig: Wellen rus, Mit diesem letzten Einsammeln von Brennstoff für den Holzstoß ist noch heute in Kelbra das „Todaustragen“ verbunden. Der Brauch wurde früher in vielen Ortschaften geübt, und zwar nicht zu Ostern, sondern zu Lätare, dem schwarzen Sonntage.[26] Weil sich diese Sitte dort am längsten gehalten, wo die Frauen nach wendischem Brauche in weißer Gewandung trauerten, meint man, das „Todaustragen“ sei nicht ein germanischer, sondern ein wendischer Brauch. Tatsächlich finden wir es aber bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in vielen deutschen, keinem slavischen Einfluß ausgesetzten Dörfern, besonders Thüringens. In Kelbra führt man am ersten Ostertage auf einem Wagen eine mit alten Kleidern behangene Strohpuppe, den „armen Tod“, durch die Straßen: Die begleitende Jugend ruft höhnisch dazu: Teilt dem armen Tod auch 'was met, Am Abend wird diese Puppe auf den brennenden Holzstoß geworfen und verbrannt. Nach den Formen, in denen in unserer Heimat das Herumsühren und der Flammentod des Strohmannes vor sich geht, kann man diese Verbrennung nicht als alten Opfer- brauch ansprechen, sondern nur als endgültige Abfertigung des Winters.[27] Selbstverständlich haben bei allen heidnischen Festen Opferungen stattgefunden, aber sie haben nicht überall so im Mittelpunkt gestanden, wie es zuweilen hingestellt wird. Schon die Tatsache, daß uns das germanische Wort für Opfer nicht erhalten geblieben ist, beweist, daß die Germanen das Opser nicht bei jeder Kulthandlung als das Wesentliche ansehen. In der allerdings sehr rauhen nordgermanischen Spätzeit wird ja sogar gelehrt, karg im Opfern zu sein.[28] Und nun flammen die Osterfeuer am Abend des ersten Ostertages aus. Alt und jung versammeln sich um den prasselnden, glühenden, Feuergarben zum blauschwarzen Himmel sendenden Holzstoß. Vom fernen Kyffhäuser im Osten bis zu den Tafelbergen Bleicherodes und des Ohmfeldes im Westen, von den Vorhöhen der Hainleite bis zum Harzrande und zwischen diesen Höhenzügen aus der Aue und den rötlichen Gesilden des oberen Wipper- und Helmetales lodern die Feuer und tragen die Grüße herüber von den Menschen, die daselbst ebenso fröhlich und andächtig versammelt sind wie diejenigen des eigenen Feuers. Nicht eine kleine Gemeinde, sondern eine ganze weite Landschaft fühlt in diesem Augenblicke ihre Glaubensverbundenheit und ihre Schicksalsverbundenheit seit Jahrtausenden, und die feierliche Stille, während die Flammen am höchsten emporschießen, senkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Liebe zur heimatlichen Scholle tieser in die aufgeschlossenen Herzen, als es rauschende Kundgebungen je vermögen. Nicht mehr üblich ist es bei uns, daß der Bursch mit seinem Mädchen über das ausglühende Feuer springt. Ebenso hat das Schwärzen der Mädchen mit den verkohlten Resten des Holzes allen Sinn verloren und wird in Urbach und anderen Orten höchstens noch als harmloser Schabernack geübt. Dagegen ist bis vor kurzem noch das „Fackelschwingen“, wie es in Haferungen und Ilfeld, oder das „Schwärmen“, wie es in Mörbach und Nohra genannt wird, in Brauch gewesen. Aus dem Osterfeuer gerissene Brände oder ins Feuer getauchte und in Brand gesetzte Knüppel und Besen werden jubelnd herumgeschwungen, wieder und wieder gedreht und schließlich emporgeschnellt. Das Sonnenrad wird nachgeahmt, und das Schwingen der Fackeln soll der Sonne zum Siege verhelfen und die Winterdämonen vertreiben.  Die reinigende und sühnende Kraft des Osterfeuers teilt sich auch der Asche mit. Früher wurde sie für den Wiesendung verwertet, oder die abgeschwelten Wellen wurden in den Futtertrog getaucht; dann, so meinte man, bleibe das Vieh gesund, wie man in Ilfeld, Haferungen, Furra u. a. Ortschaften glaubte. Vom heidnischen Brauchtum hat die katholische Kirche ein weihevolles Begängnis übernommen. Sie entzündete am Ostersonnabend früh in oder vor der Kirche ein Osterfeuer, um von dieser Quelle aus alle übrigen Feuer, insbesondere auch die Herdfeuer in den Wohnungen, aufs neue in Brand zu setzen. Das verkohlte Holz vom geweihten Feuer aber bewahrte man auf, malte damit zu Walpurgis drei Kreuze an die Türen und verbrannte erst die Scheite bei drohenden Gewitters Gefahr. Leben zu spenden, Leben zu fördern, werden die Gottheiten zu Ostern angerufen. Neben dem Feuer gehört zum Erhallen, Fördern, Erquicken allen Lebens das Wasser. So wird zu Ostern auch das Wasser durch vielfältiges Brauchtum gefeiert. Leider hat sich nur noch wenig von den Sitten, die sich um die Verehrung des Wassers gruppieren, erhalten, und wo der Väter Weise noch im Schwange, ist doch der ursprüngliche Sinn des Brauches so gut wie ganz dem Gedächtnis entschwunden. In manchen Dörfern, z. B. in Görsbach, gießt man noch heute am Ostermorgen dem Nachbarn oder guten Freunde Wasser in die Stube oder in den Keller. Oder den Mädchen, die zu lange ge- schlasen haben, überschwemmt man die Zimmer. Doch gelten diese Bräuche eigentlich nur als Unfug. Hie und da ist es noch Sitte, am Ostermorgen das Vieh mit Wasser zu besprengen; in Tettenborn besprengen sich am Abend vor Ostern die Knaben gegenseitig mit Wasser. Zu Grunde liegt natürlich derselbe Glaube vom tüchtigmachenden, die Fruchtbarkeit fördernden Wasser wie beim Wassersegen, der den Konfirmanden von Furra und Rüxleben zuteil wird. Noch vielfach üblich ist es, den Knecht oder die Magd, die im Jahre zum ersten Male zum Gras- oder Grünfutterholen ins Feld gehen, oder wenn sie von der Arbeit kommen, mit Wasser zu begießen. In Heringen besprengt man den Schäfer, wenn er das erste Mal heraustreibt, in Groß-Berndten die Frau, die das erste Gras in der Kiepe heimholt, in Nohra die Knechte. Doch vom tieferen Sinn weiß das Volk nicht mehr viel. „Damit sie nicht faul werden im Jahre“, heißt es gemeinhin. Wer an einem solchen Tage wie dem Ostertage, an dem alles zum Leben und zur wackeren Arbeit erwacht und tüchtig wird, die guten Stunden verschläft, dem kann natürlich nichts gedeihen. So sagt man in Liebenrode, daß der Bauer, der sogar am ersten Ostertage mittags sein Schläfchen halten muß, sich Dornen und Disteln auf sein Land schläft. Der eigentliche Sinn des Osterwassers als Lebenswassers tritt nur zutage bei dem noch selten geübten Wasserschöpfen. In der Osternacht um 12 Uhr ganz heimlich und ganz lautlos schöpfen es die Mägdlein aus fließendem Wasser. Von den Haferungern, Mörbachern, den Lipprechterödern, den Liebenrödern, den Nohraern und Oberdörfern haben wir es gehört. Die jungen Mädchen aus Petersdorf gingen einst bis nach dem Gesundbrunnen bei Nordhausen, um Osterwasser zu schöpfen. Auch werden wohl noch andere ans fließende Master gehen, doch teilen sie es nicht gern mit, weil alter schöner Brauch heute leider gar leicht der Lächerlichkeit verfällt. Auch brauchen die Buben nichts vom Wafferschöpfen der Mädchen zu wissen, sonst kommen sie dazwischen, lärmen, stellen törichte Fragen und suchen auf alle Weise die Schweigsamen zum Plappern zu bringen. Dann aber ist es aus mit der Zauberkraft des Lebenswassers. Der Ueberlieferung nach soll das Wasser mit dem Strome geschöpft werden, ein sehr schwieriges Beginnen. Doch nur aus Sülzhayn war dieser Brauch in Erfahrung zu bringen, sonst hieß es, man entnehme das Wasser gegen den Strom. Dieses in der Osternacht gewonnene Wasser hält sich das ganze Jahr, hilft gegen Hautunreinigkeiten und Sommersprossen besser als jedes teure Kosmetikum, heilt auch die Wunden. Vom Christentum in den alten Glauben hineingebracht ist natürlich die Ansicht, das Wasser wandele sich in der Osternacht in Wein. So wird vom Siegenborn bei Steinbrücken berichtet und vom Sachsengraben bei Obersachswerfen. Ostern soll Feuer und Wasser alles in der Entwicklung Stehende fördern, tüchtig machen und kräftig. Doch wird es nun Zeit, diese Tüchtigkeit zu prüfen und zu versuchen. Aus den uralten Wettspielen, Wettkämpfen und Wettrennen der Germanen, die veranstaltet wurden, wenn die Witterung und der grüne Rasen es wieder gestatteten, haben sich unsere Osterballbräuche entwickelt. Wer seine Tüchtigkeit und Mannbarkeit schon erwiesen hat, regt die nachfolgenden Jahrgänge an, die Kräfte zu messen für den Nachweis des eigenen Standes der Entwicklung. Noch weit verbreitet bei uns ist die alte schöne Sitte, daß das jüngste Ehepaar im Orte entweder zu Palmarum oder — häufiger — zu Ostern Bälle an die Knaben und jungen Burschen, Nadelkissen oder Halstücher an die Mägdlein verteilt. Am ersten Ostertage ziehen die jungen Burschen unter fortwährendem Rufen:
vor das Haus des jüngsten Ehepaares. In Wolkramshausen heißt es:
oder:
Der Ruf erschallt nämlich nach dem Kirchgänge am 1. Ostertage. Dieser dringenden Aufforderung kommen dann die jungen Eheleute schleunigst nach, der Ehemann wirft die Bälle, die Gattin die Nadelkissen heraus. Bei den sich nun entwickelnden Wettkämpfen mit dem Balle wird sich herausstellen, wer der tüchtigste und gewandteste Bursche ist. Und an den Nadelkissen können sich die Dirnlein erproben. Oder aber, während die Knaben ihr Spiel abhalten, lausen die Mädchen nach den als Preise ausgesetzten Tüchern. Die Sieger in den Spielen dürften kraft ihrer Tüchtigkeit das meiste Anrecht daraus haben, das bisher jüngste Ehepaar abzulösen, aus daß es nicht mehr das jüngste bleibe. Die Wettspiele gehen in den einzelnen Orten recht verschieden vor sich. In Rüxleben und Haferungen spielen die Knaben Ball, die Mädchen lausen nach Tüchern. In Sülzhayn mußte einst in guten Zeiten die Siegerin am weißen Sonntage, dem Sonntag nach Ostern, ihren Kameradinnen einen Kaffee geben. In Nohra bekommen die Knaben kleine Bälle, die Burschen und Männer je einen großen Ball, mit dem sie ein Kreisballspiel verunstalten. Schließlich wird der Ball versteigert, der Erlös wird in der Schenke verjubelt. In Groß-Berndten findet das Ballspiel Palmarum statt. Hier singen die Kinder die Bälle aus, die Burschen erhalten sie zugewiesen, und die Männer versteigern einen großen Ball. Ein Ballspiel der männlichen Jugend, ein Wettlauf der weiblichen nach Tüchern und Haarschleifen schließt sich an. In Groß-Furra haben sich die Spiele nicht mehr gehalten, sondern es werden die Bälle und Nadelkissen nur noch ausgegeben, ohne daß sich ein Spiel anknüpft. In Niedersachswerfen ist der alte Brauch sogar so weit gesunken, daß nur noch die Kaufleute die Kinder mit Bällen oder Schieferstiften und anderen Kleinigkeiten beschenken. Doch war der Brauch des Spiels und des Wettlaufs in unserer Heimat so allgemein verbreitet, daß er sich selbst in dem der Hauptstadt unserer Landschaft Nordhausen so nahen Crimderode noch lange unverfälscht erhalten hat. Zu Palmarum zogen die Kinder in die Wohnungen der jüngst Verheirateten und erhielten dort, die Knaben Bälle, die Mädel Nadelkissen. Reichten Bälle und Nadelkissen nicht aus, so gab es wohl auch Brezeln und Schieferstifte. Am Nachmittage bekamen die Burschen von der jungen Frau einen größeren Ball, den Brautball. Dabei sangen sie: Grüne Laub, grüne Staub, Auf der Gemeindewiese entwickelte sich dann ein Spiel ähnlich unserem noch überall üblichen Schlagballspiel.[29] Diese Osterfeier, die wichtigste Frühlingsfeier, leitete einstmals eine ganze Reihe von weiteren Frühlingsfeiern ein. Zu Ostern, am Tage der Tag- und Nachtgleiche, hatte man die Sonne gefeiert, und nun, wo sie von Tag zu Tag länger ihre segnenden Strahlen herniederschickt und das Blühen und Treiben kein Ende nimmt, mußte man fröhlich sein in der fröhlichen Natur. Heute sind von den vielen Bräuchen der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten nur noch ganz kümmerliche Reste erhalten. Aus reichlich fließender Ueberlieferung wissen wir, welche Bräuche bis tief ins 19. Jahrhundert hinein geübt worden sind; wenn man aber heute in die Dörfer kommt und nach dem alten Brauchtum forscht, begegnet man meistens nur Kopfschütteln, und den ältesten Leuten fehlt die Erinnerung an ihren einstigen kostbaren Besitz. Die alten so sinnvollen und doch so selbstverständlichen Spiele sind dem komplizierten und verwöhnten Menschen der heutigen Zeit zu einfach, sie mußten modernen, mit den Errungenschaften unserer Technik ausgestatteten Unterhaltungen weichen. Anstelle der schönen Bänder- und Reihentänze sind längst die modernen Rundtänze getreten, die womöglich allsonntaglich stattfinden und durch zu häufige Veranstaltung den Sinn für seltener begangene, aber edlere und beziehungsreiche Volksfeste abgestumpft haben. Nur die reichliche Verwendung von Grünschmuck in dieser grünenden und blühenden Jahreszeit bei allen möglichen Gelegenheiten hat sich noch erhalten. Am Himmelfahrtstage und zu Pfingsten erinnern noch Ausflüge und Tänze an die einstige Herrlichkeit, lassen aber auch unsere heutige Verarmung an wahrhaft sinnvollen und zweckvollen Begehungen deutlich werden. Vor allem die modernen Verkehrs- und Nachrichtenmittel sorgen dafür, daß das alte Brauchtum nicht wiederersteht. Zu ändern ist das nicht; das zeigen alle Versuche, neue Belebung alter Kultur zu erreichen. Von der Neuromantik des Wandervogels seit der Jahrhundertwende bis auf die Versuche in jüngster Zeit beweisen die Bestrebungen, daß alle Voraussetzungen dafür abhanden gekommen sind. Die äußeren Lebensformen sind andere geworden, vor allem aber auch unsere seelische Haltung. Das Lebenstempo und der um ein Vielfaches härtere Daseinskampf hat uns zurück zur Natur und zu zweckmäßiger Lebenshaltung geführt; aber auch hier können wir nicht mehr nur spielen und Feste feiern, sondern müssen kämpfen und uns stählen für den bald wieder einsetzenden stahlharten Lebenskampf. Wir bedauern das nicht. Vielleicht aber kann das Misten um einstiges sorgloseres Hingeben an den Tag und die Natur, die Freude über so viel unbekümmertes Feiern, die Erinnerung an die größere Einheitlichkeit und Selbstverständlichkeit alles Tuns auch aus unser seelisches Gleichgewicht einwirken. Dann fühlen vielleicht auch wir noch von einem güldenen Morgenstrahl, der aus versunkener Herrlichkeit zu uns herüberglüht, ein stilles, verklärendes Leuchten. — In der Frühlingszeit nach Ostern hat der Mensch besonders seine Freude an dem frischen, Hellen Grün von Laub und Gras und verwendet es wieder und wieder. Die Heiligtümer wurden einst mit Binsen und Laub bestreut und von Pfosten zu Pfosten reiche Gewinde gezogen. Die Wohnungen wurden mit dem Grün des Lebensbaumes, der Birke, geschmückt. Aber nicht nur der einzelne stellte an Türen und Fenster die Maie, sondern auch die Weiler und Ortschaften richteten den Maibaum auf. Arbeitsbereite, fröhliche Hände schälten ihn ab, und kräftige Iünglingsfäuste richteten ihn auf, nachdem er oben mit dem Maibüschel versehen war. Ob freilich dieses Schälen wegen des Ungeziefers geschah, das zwischen Holz und Rinde sein Unwesen treibt und in das unholde Geister eingegangen sind, die durch das Schälen zum schmählichen Abzug gezwungen werden sollen, möchten wir dahingestellt sein lassen. Vielleicht ist die Deutung zu schön und scharfsinnig, als daß sie richtig wäre, und das Schälen des Stammes hat nichts weiter auf sich, als ihn recht glatt und ansehnlich herzustellen.[30] Bei allem diesen Schmücken und Putzen geht es recht lustig und lärmig zu, es wird ein „Heidenlärm“ gemacht, vielleicht nur zur Bekundung der Freude, vielleicht aber einst auch mit dem tieferen Sinn, alle bösen Dämonen zu verscheuchen. Und wenn man sich dann so auf die Maienzeit vorbereitet hat, kann man auch den Maikönig oder den Maiprinzen einholen. Ein Spiel wird veranstaltet, das den Einzug des lichten, mit allen seinen Gaben geschmückten Frühlingsgottes symbolisieren soll. Dieser Maienprinz, also der Frühlingsgott, wird im festlichen Zuge eingeholt, nachdem er lange genug hat auf sich warten lasten und nachdem mancher Bittgang und manches Suchen nach dem langersehnten Frühling vergebens gewesen.[31] Bei uns begann Elende mit diesem schönen Frühlingsfest des Einholens des Maikönigs. Am dritten Ostertage wurde der jüngste Ehemann, der sich versteckt hielt, von den Burschen des Dorfes ausgesucht. Beim Suchen mußte ein Heidenlärm mit Johlen, Trommelschlagen und Peitschenknallen gemacht werden. Hatte man ihn in seinem Versteck ausfindig gemacht, so wurde er aus den nahen Osterberg geführt, wo ihm ein Teller mit Knospen vorgesetzt wurde, von denen er einige essen mußte. Dann wurde er, damit der kostbare Prinz ja nicht wieder entlaufe, mit Stricken gebunden und ins Dorf zurückgeführt. Doch um die Freude zu verlängern, gab man ihm unterwegs Gelegenheit, sich zu befreien und in den Wald zu flüchten. And nun gab es noch einmal ein lustiges Spiel, bis man ihn wieder hatte und ins Dorf zur Schenke führte, wo er sich mit einem Fäßchen Bier loskaufen mußte. „In die Knospen treiben“ nannte man das Fest, und das Dörfchen Elende hat den Ruhm, es bis in die jüngste Zeit beibehalten zu haben. Seit einigen Jahren ist es nicht mehr begangen worden, „wegen der schlechten Zeiten“, wie man mitteilte. Ganz ähnlich ging die Einholung des „Schoßmeiers“ in Deuna vor sich, wo sich ein mit Gras und grünen Reisern ganz umhüllter Knabe im Walde verbarg, gesucht und schließlich unter Freudenbezeugungen ins Dorf zurückgeführt wurde. Dort sammelten dann die Burschen Gaben ein, den Schoß, weshalb der Maiprinz auch „Schoßmeier“ genannt wurde. Daß in unserer Heimat in ihrer ganzen Ausdehnung diese nunmehr ausgestorbenen Feste voreinst im Schwange waren, geht daraus hervor, daß ebenso wie Tilleda im äußersten Osten Hauröden im äußersten Westen zur Maienzeit ihren „wilden Mann“ aus dem Holze holten. In Kelbra-Altendorf läuft ein mit Birken umkleideter Knabe, der Maiprinz, unter dem Lärm seiner ihn begleitenden Gespielen durch die Straßen; in Bennungen putzte sich der Maikönig mit Maien heraus und versah sich mit einer Maske. Auf dem Kopfe trug er eine Krone mit Glöckchen. Er versteckte sich, und wenn er gefunden war, mußte erraten werden, wer unter der Maske verborgen sei. Wenn die Umstehenden falsch geraten, schüttelte er mit dem Kopfe, daß die Schellchen erklangen. In Thürungen feierte man in gleicher Weise wie in anderen Dörfern das Einholen des Maiprinzen, nannte es aber das „Froschkönigfest“. Morgens wurde ein junger Bursche vom Kopf bis zu den Füßen mit frischem Grün bedeckt. Dann wurde er von einigen seiner Kameraden in einer Wiese versteckt. Am Nachmittage machte sich die Dorfjugend beritten und zerstreute sich zur Suche durch die Fluren. War er gefunden, setzte man ihn triumphierend auf ein Pferd und führte ihn durch die Straßen des Dorfes. Ein Tanz beschloß das Frühlingsfest. Recht fröhlich und beziehungsreich hat man das Fest das „Froschkönigsfest“ genannt. In den Auewiesen um Thürungen herum sind genügend Frösche daheim, im Frühjahr vermehren sie sich auch in so erfreulicher Weise, daß man ihre Fruchtbarkeit gern auf alle Früchte des Feldes und auf die Menschen übertragen möchte; ein grünes Röckchen haben sie auch an, wie alle Kinder des Frühlingsgottes: so ist der Maikönig der Froschkönig geworden. Auch dieses Fest hat sich lange gehalten, wird aber jetzt nicht mehr begangen. Es gäbe heut' keine Militärentlassenen mehr, insonderheit Kavalleristen, die das Reiten verstünden und immer zu allerlei Feierlichkeiten und Späßen aufgelegt gewesen seien, gab man als Grund an für den Ausfall des Festes seit einem Jahrzehnt.[32] An die Stelle aller dieser Frühlingsfeiern ist heute in vielen Dörfern ein allerdings nicht regelmäßig gefeiertes Begängnis getreten, die Altweibermühle, ein gröberes Fest als die früheren; aber durch alle moderne und in den einzelnen Ortschaften verschiedene Ausgestaltung kann man doch noch manches Stück alten Brauchtums erkennen, das aus der Erinnerung an andere Feste entlehnt und modern ausgestaltet ist. Im Wirtshause wird eine Mühle aufgebaut, und nach dieser Mühle begibt sich ein seltsamer Zug. Da finden wir einen großen und einen kleinen mit Erbsstroh umhangenen Bären, auch wohl einen Mann mit weißgekleidetem Antlitz, der den Tod darstellen soll. Diese Gestalt symbolisiert den sterbenden Winter, den „armen Tod“, wie er in Kelbra heißt. Dann sind da geschwärzte Männer im Zuge zu sehen, uns auch schon bekannte Gestalten, die sich mit der Deckfarbe versehen haben, um von bösen Dämonen nicht erkannt zu werden und dem Tode zu verfallen. Der Pritschenmeister oder Baias, der den Zug anführt, tut allerdings mit dem Ge- klatsche einer Pritsche das Menschenmögliche, die schlimmen Geister zu vertreiben und die dem Tode und den Bären folgenden alten Weiber zu retten. So gelangt man in das Wirtshaus und vor die Mühle. Da wandern nun die als alte Weiber Verkleideten hinten hinein, die Mühle wird gedreht, und siehe, vorn aus der Mühle schlüpfen die jüngsten und appetitlichsten Jungfräulein heraus, die alsbald mit den Burschen recht munter und altersunbeschwert zu tanzen beginnen. — Alles neu macht der Mai! — Hin und wieder wird freilich die Freude am Frühling und an der linden Witterung getrübt durch böse Gegenangriffe und Rückzugsgefechte des Winters. In der christlichen Zeit sind es die drei Eisheiligen Mamertus, Pankratius und Servatius, die nochmals Nachtfröste und Unbeständigkeit des Wetters bringen. In urheidnischer Zeit war es am 1. Mai, wo das wilde Heer noch einmal durch die Lüfte brauste. An diesem Tage soll Wotan mit Frija das Fest der Vermählung begehen; an die Stelle Frijas setzte das Christentum dann die heilige Walpurg, weshalb der 1. Mai der Walpurgistag ist. Alles scheint aber darauf hinzudeuten, daß der 1. Mai für unsere Vorsahren eine andere Bedeutung hatte und daß der Glaube, der an diesem Feste haftet, älter ist als die Vorstellung von Wotan als höchstem Himmels- gotte. Erst in der kriegerischen Zeit der Jahrhunderte nach Christi Geburt hat ja der westgermanische Wotan seine überragende Stellung unter den Göttern erhalten und ist dann als Odin auch von den Nordgermanen übernommen worden. Ursprünglich aber war er das, wozu ihn das Christentum später wieder gemacht hat, ein Wetterdämon, der mit seinen Sturmmädchen, den Walkürien, das Meer peitscht und in wilden Nächten durch das zersetzte Wettergewölk fährt. Als solcher saust er am 1. Mai an der Spitze der Walkürien oder Hexen in wildem Ritt durch die Lüfte.[33] Unser Volk kennt also den wilden Wote aus einer früheren Zeit als die deutsche Heldensage. Daß die wilde Jagd am 1. Mai den Brocken als Ziel hat, ist erst ein aus dem 16. Jahrhundert stammender Glaube. Dieser aber ist ein Rest letzter Erinnerung an die altgermanischen Opferfeiern auf hohen Bergkuppen, bei denen auch Opfertänze statt- gefunden haben mögen. Für das christliche Mittelalter wurde das Wesentliche der Ritt der wilden Jagd durch die stürmische Nacht. Er ist deshalb früher auch in unserer Heimat allenthalben nach- geahmt worden. Knaben schnitzten sich zum 1. Mai Weidenruten, schälten sie und ahmten auf ihnen den Ritt nach. In Wallhausen hat man diesen alten Brauch 1927 zu erneuern versucht?) Sonst stellt man sich seit dem ausgehenden Mittelalter die Hexen auf Ofengabeln und Besen reitend vor. Ein Besen, vor die Haustür gestellt, schützt vor den Hexen; Distelstöcke in den Hausflur gehängt, ein Hufeisen auf die Schwelle der Tür gelegt, wehrt ihnen den Eintritt. Vor allem aber muß man aus Kreide oder noch besser aus Kohle nach Sonnenuntergang drei Kreuze an die Haustür machen, wie es noch vor Jahren in Elende, Groß-Furra, Rehungen, Rottleberode üblich war. In Bischofferode müssen die Kreuze von der Holzkohle des Osterfeuers gemalt sein, sonst helfen sie nichts. Diese Kohle in der Tasche gewährt Schutz vor den Nachstellungen der Hexen. Der Neugierige, der durchaus den Hexenritt sehen will, muß sich um Mitternacht auf einen Kreuzweg in recht unbequemer Lage hinlegen, unter eine Egge, deren Zinken nach oben gerichtet sind. Im Anschluß an den Glauben vom Hexenritt wird unbeliebten Mädchen in der Walpurgisnacht auch manch' Schabernack gespielt. In Haferungen stellt man Langschläferinnen Ofengabeln oder Besen ans Bett und meint, sie schliefen so lange, weil sie sich von den Anstrengungen des Brockenerlebnisses ausruhen müßten. In Lipprechterode stellt man ihnen Dornwellen vor die Tür. Auf dem Eichsfelde war man einst noch unhöflicher. Burschen mit Gießkannen, Blashörnern, Peitschen zogen vor die Tür ältlicher Mädchen und volführten da einen furchtbaren Lärm, legten auch Eggen hin, damit die Hexe nicht ausreiten könnte. Ein Tag wichtigen Brauchtums ist der 1. Mai immer für den Harz gewesen. Hier haben sich einige der Bräuche auch bis auf den heutigen Tag gehalten, weil sie mehr mit dem täglichen Leben und seinen Wirtschaftsformen verknüpft sind. Am 1. Mai muß im Harze Schnee und Eis von allen Straßen und Plätzen fortgeschafft sein. Vom 1. Mai ab darf keiner mehr die Harzwiesen betreten. Am 1. Mai findet auch der Austrieb der Herden statt; der Hirte in seiner historischen Tracht, in blauem oder schwarzem Kittel, Hellen Tuchgamaschen, schwarzem, federgeschmücktem Hut, schwarzledernem Schulterriemen mit Messingbeschlägen treibt zum ersten Male die Kuhherde aus und ist an diesem Tage der gefeierte Held, den man mit Blumen schmückt und den man wohl auch auf seinen ersten Weideplatz begleitet, wo man zusammen mit ihm einen Umtrunk veranstaltet.  Ganz in den Pfingstkreis mit seinen vielen Volksfesten kommen wir um Himmelfahrt hinein. Es sind zumeist Feste, die einzelne Gruppen von Menschen, welche ihrem Stande, ihrem Brauchtum, ihrem Gewerbe nach zusammengehören, veranstalten. Um Pfingsten hielten die Ritter ihre Turniere, die Bürger ihr Armbrustschießen ab, Innungsfeste wurden gefeiert, gesellige oder religiöse Vereine machten ihre Ausflüge. Hierher gehört auch das berühmte Merwigslindenfest der Nordhäuser Schuhmacher und Gerber, das bis ins 18. Jahrhundert hinein zunächst alle Jahre, später alle sieben Jahre veranstaltet wurde. Den Zug leiteten ein Musikkorps und die Innungsfahne ein, dahinter marschierten die Innungsmeister in vollem Waffenschmucke, dann die Gesellen und schließlich die Lehrbuben. Auch alle Angehörigen durften sich anfchließen, und so zog man in buntem Zuge nach der alten Merwigslinde, die damals noch einsam in Gras und Heidekraut auf der Höhe des Geiersberges stand. Hier lagerte man sich und hielt ein ausgelassenes Fest. Am Abend aber brach sich jeder einen Zweig von der Linde und trat, mit diesem geschmückt, den Rückmarsch an. Als sich die Gerber 1734 von den Schuhmachern trennten und deshalb bei dem Feste Reibereien hätten entstehen können, verbot der Rat der Stadt Nordhausen 1736 das Fest. Ein anderes altes, von edelstem Väterglauben durchwobenes und innigstes Naturempfinden beweisendes Frühlingsfest ist die Maien- oder Rutenlese, die nun leider auch schon mehr als 100 Jahre unterblieben ist. Die Birke ist der Baum der Maienzeit. Sie prangt am längsten im Hellen, freudevollen Grün der freudevollen Zeit, ihr Stamm ist schlank und rank, ihre Zweige sind geschmeidig und biegsam wie die Jugend. Sie ist deshalb in erster Linie das Symbol des Heranwachsenden Lebens, und ein Schlag mit einem ihrer Zweige fördert Wachstum und Kraft und Fruchtbarkeit. So ist die Birke so recht der Baum der heranreifenden Schuljugend geworden. Jahrhundertelang ist einst die Nordhäuser Jugend, sind die Domschüler und später in protestantischer Zeit die Gymnasiasten in der Woche vor Pfingsten drei Tage lang in den Kohnstein gewandert und haben dort auf den hohen Gipsfelsen über Niedersachswerfen, wo noch heut' die Birken stehen, Maien geschnitten. Drei Tage feierte die Schulgemeinschaft draußen in den herrlichen Wäldern unserer Heimat ihr Schulfest. Reigen und Wettspiele, Wanderung und Rast wechselten ab, und zwischendurch wurden die Birkenreiser geschnitten. Diese wurden dann am Abend jeden Tages auf einen Wagen geladen und bis vor das Altentor gefahren. Hier wurden sie den Schülern von dem Wagen gereicht, die Schule stellte sich auf, jeder Schüler mit einer Maie. Die Kleinen begannen den Zug mit den schwächsten Zweigen, hinterdrein marschierten die Großen mit kräftigen Aesten. Der Zug führte durch die Stadt bis auf den Markt. Hier zwischen Rathaus und Weinkeller schloß man einen Ring, hob die Maien empor und „hielt, als in einem schönen Lustwald stehend, eine Musik“, wie der Chronist sagt. Dann wurden die Maien an die Bürger verteilt. Es blieben aber auch immer noch genug für die Schule selbst übrig zu ihrem Gebrauch während des langen Schuljahres, auf daß die Reiser bei der Erziehung die nötige Hilfsstellung gäben, die Faulheit in Fleiß verwandelten, zur Aufmerksamkeit anspornten und in allzu langsames Denken das nötige Tempo hineinbrächten.[34] Nach dem Glauben unserer Vorfahren hat ein Schlag mit der Birke Glück und gutes Vorwärtskommen im Gefolge. Die Nordhäuser Gymnasiasten jener Zeit werden wohl viel Glück im Leben gehabt haben und sämtlich trefflich vorwärtsgekommen sein. 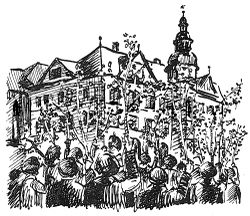 In der Freude über die schöne Maienzeit gedachten unsere Vorfahren auch des Gottes, der den Aeckern Fruchtbarkeit schenkt. Wie der Grüne Donnerstag vor Ostern, war ein Tag auch im Mai dem Gotte Donar geweiht. Es ist unser christlicher Himmelfahrtstag. Ein Glaube erinnert noch heute an den Donnergott: Am Himmelfahrtstage darf man keine weibliche Handarbeit vornehmen, sonst schlägt der Blitz ins Haus. Sonst aber hat das Christentum der früheren Jahrhunderte aus der Zeit um Pfingsten herum einen sinnvollen Brauch aus dem Heidentum übernommen. Bei unseren heidnischen Vorfahren fand an diesem Tage bei Sonnenaufgang eine Bittprozession in die Felder statt, bei der Götterbilder mitgeführt wurden und deren Schluß die Opfertiere machten, die man dem Gotte der Fruchtbarkeit darbrachte. Dieser Tag, den später das Christentum Himmelsahrtstag nannte, war tatsächlich ein Opfertag erster Ordnung für die Germanen.[35] Das Christentum hat aus diesem heidnischen Bittgang ein christliches Begängnis gemacht mit gottesdienstlicher Handlung mitten im Felde, um des Himmels Huld auf die Fluren Herabzurufen.[36] Für Nordhausen ist bis in den Ausgang des 18. Jahrhunderts ein solcher Feldgottesdienst zwar nicht für den Himmelfahrtstag, aber für den zweiten Pfingsttag bezeugt. So erzählt uns der wackere Nordhäuser Chronist Bohne, daß noch im 18. Jahrhundert beim Hospital St. Cyriaci vor dem Siechentore jährlich drei Feld- und Flurpredigten abgehalten seien, am 2. Ostertage, am 2. Pfingsttage und im August vor oder nach Cyriakus „bei angehender Ernte“. Die Flurpredigten fanden damals vor dem Siechenhofe statt, früher ist aber sicher eine Prozession unter Vorantragen des Bildes des heiligen Cyriakus ins Feld hinaus erfolgt. Noch im 18. Jahrhundert war der Siechhof vollständig von uralten Linden umgeben, und hier im Schatten dieser Linden versammelte sich die ganze Nordhäuser Gemeinde am 2. Pfingst- tage zu andächtigem Feldgottesdienst. Das Fest war weithin berühmt, so daß es auch viele Fremde anlockte, „worunter auch vielmahls vornehme von Adel von Mann- und Weibspersonal auf ihren Chaisen und Carossen dorthin aus sonderlicher theils Pietät theils Curiosität fuhren …“ Beim Gottesdienste wurde „dem allmächtigen Gölte die Wohlfahrt … des Landes und der Feldfrüchte inbrünstig … empfohlen“.[37] Dergleichen Prozessionen und Feldgottesdienste sind für die Monate Mai und Juni aus unserer Heimat noch eine ganze Neihe bezeugt. Hier sei nur daran erinnert, daß am Fuße des Bauersberges südlich Trebra der Steinborn liegt, an dem am Himmelfahrtstage ein Volksfest stattfindet. Einst, in katholischer Zeit, ging am Johannistage eine Prozession zu der dort gebauten Kapelle.[38] In diesen Tagen des ausgehenden Mai und beginnenden Juni bittet man aber nicht nur um ein ungestörtes Heranreifen der Feldfrüchte, sondern man weiß auch, daß sich die unerschöpflichen Kräfte der Erde und das geheimnisvolle Fruchttragen der Halme auch auf die Menschen übertragen kann, die sich ja nur als ein Stück dieser Gesamtnatur fühlen. Wie die Bewohner uns besonders vertrauter Ortschaften mitteilten, ist es deshalb noch heute Brauch, daß junge Ehepaare, die noch keine Kinder bekommen haben, um den Junibeginn herum zu stiller Stunde in das auf grünem Halme stehende Korn gehen und dort erhoffen, ihr Bund werde vom Donar oder Freyr, den Fruchtbarkeitsgöttern, gesegnet, wie diese Götter den Schoß der Erde gesegnet haben. Für die Pfingsttage selbst ist leider an altem Brauchtum so gut wie nichts mehr übrig geblieben, als daß man noch die Pfingstmaie vor die Häuser setzt und Ausflüge macht. Allgemein üblich ist noch heute, daß die Burschen ihren Mädchen Maien darbringen; den unbeliebten aber werden Dornsträucher vor die Tür gesetzt, und es ist gut, daß weder der Beleidiger noch die Beleidigte den tieferen Sinn dieser Handlung verstehen. Denn ebenso wie die Birke das Symbol für alles Lebensfrische, Fruchtbare ist, so ist der Dorn das Symbol für alles Absterbende und Unfruchtbare. Auch Strohmänner werden wohl mißliebigen Schönen auf das Dach gesetzt, wie es aus Haferungen und Nohra noch für die jüngste Zeit bezeugt ist. Nicht mit einem vollsaftigen Prachtkerl, sondern mit einem Strohmann sollen sich die armen Mädchen begnügen. Früher fanden Pfingsten außerdem die schönsten Volksfeste statt. Ueberall im Hohensteinschen zog man einst auf den Pfingstrasen, einen Platz, den noch heute beinah jedes Dorf besitzt. Dieser Pfingstrasen wurde Ostern mit abgeschälten Weiden gehegt, diente nur zur Pferde-, nicht zur Kuhweide und wurde erst nach Pfingsten, am Pfingstmittwoch für die Kühe freigegeben, die dann festlich geschmückt als „Bunte Kühe“ oder „Pfingstochsen“ auf die Weide geführt wurden. Auf diesem Pfingstrasen fand am 2. Pfingsttage ein Ringel- und Kranzstechen der Bauernburschen statt, eine offenbar ritterlichem Brauch nachgeahmte Veranstaltung. An einer Schnur zwischen zwei Pfählen hing ein Kranz, und die Burschen mußten, der Reihe nach anreitend, versuchen, den Kranz herabzustechen. Der 3. Pfingsttag galt dann an vielen Orten als Burschentag, den die Burschen ihren Mädchen gaben, wofür diese sich 14 Tage oder 3 Wochen später durch einen Mädchenball erkenntlich zeigen mußten. Auch bei diesen Tanzvergnügungen betätigte sich der Baias, trieb seine Späße, wirkte als Tanzordner. In Oberdorf zieht am 2. Pfingsttag der Erbsbär herum, dem der Baias auf einem Schimmel voranreitet. Nach diesem Umzüge gibt es unter der Linde das Pfingstbier. Im allgemeinen aber war man am 3. Pfingsttage von all dem Feiern noch so faul und von all dem Bier noch so öde im Kopfe, daß man für tüchtige Arbeit im eigenen Haushalte noch nicht fähig war. So wurde denn dieser Tag zur Arbeit angesetzt, die alle gemeinsam und hübsch langsam und ohne allzu großes Interesse Vornahmen. Es war das sogenannte Gemeindewerken; man besserte für die Gemeinde die Wege in der Feldmark, holte die Gräben neu aus oder erprobte die Feuerspritze. Mit solchen Verrichtungen hatte man sich dann allmählich wieder in die Alltagsarbeit hineingefunden, und den nächsten Tag konnte es nun wirklich energisch an die eigene Arbeit gehen.[39] Zu diesen Pfingstfeierlichkeiten gehört für unsere Landschaft am Südharzrande auch das alte schöne Questenfest. Dieses Fest wurde 1924 folgendermaßen gefeiert und wird alljährlich ähnlich begangen: Die jungen Burschen vom Dorfe Questenberg im Südharz holen am Sonntage vor Pfingsten einen Eichenstamm aus dem Walde. Er darf mit keinem Metall in Berührung kommen, wird also auf Männerschultern — 16 Mann — vom Ursprungsorte nach dem das Dors überragenden Questenberg getragen. Hier wird der Stamm geschält. Am 1. Pfingsttage nachmittags bereiten die Burschen dann eine Setzmaie auf dem Dorfplatze. Nach Sonnenuntergang wird dieser Pfingstbaum gerichtet; er besteht aus einer geschälten Stange mit einem Maibusch daraus. Um ihn herum werden kleine Maien gestellt, welche die Pfingst- oder Tanzlaube gegen die Außenwelt abgrenzen. An dem Maibaume warten in der Nacht vom 2. zum 3. Pfingsttage die Questenberger Burschen bis „der Mann von Rothe“ mit seinen Abgaben an die Questenberger Pfarre kommt. Vor Sonnenaufgang, nach Bewirtung durch den Pfarrer verläßt dieser wieder das Dorf. Am 3. Pfingsttage gegen 2 Uhr morgens nimmt man auf dem Questenberge den alten Kranz ab vom Questenbaum und verbrennt ihn. Danach singt man einen Morgenchoral. Um 10 Uhr morgens nach dem Gottesdienste schmückt man den Baum mit einem neuen Questenkranz. Zuletzt werden drei Schüsse durch den Kranz abgegeben. Dann versammelt man sich in der Dorfschenke zum Tanz. Mit dem „Mann von Rotha“ hat es nach der Sage folgende Bewandtnis: Das einzige Töchterlein des Burgherrn der Questenburg verirrte sich einst am Pfingsttage beim Blumenpflücken im Walde. Die geängsteten Eltern boten die Einwohner der umliegenden Dörfer zum Suchen auf. Endlich am 3. Pfingsttage fanden es die Questenberger Bauern bei Rotha auf einer Wiese sitzend; es hatte einen Kranz, mit zwei Quasten daran, gewunden. Von den überglücklichen Eltern wurden die Dörfler reich beschenkt; die Rothaer erhielten die Wiese, auf der das Kind gefunden worden war, jedoch mit der Bestimmung, daß sie alljährlich am 2. Pfingsttage vor Sonnenaufgang 1 Brot und 2 Käse in die Pfarre nach Questenberg zu bringen hatten. Der Ueberbringer sollte eine Empfangsbestätigung erhalten und mit Kuchen bewirtet werden. Sein Sprüchlein bei der Uebergabe von Brot und Käse lautet: Ich bin der Mann von Rothe Wenn die Rothaer den Brauch nicht innehalten, dürfen die Questenberger das beste Rind aus der Rothaer Herde entführen. Um diesen Tatbestand und um diese Sage hat sich nun die Wissenschaft und noch mehr die Pseudowissenschaft reichlich bemüht. Der Heimatliebe und dem klaren Blick des Lehrers Fr. Schmidt aus Sangerhausen ist es zu danken, daß den Phantastereien gründlichst der Garaus gemacht worden ist. Worum es sich in den Grundzügen handelt, hat Schmidt klar herausgestellt; das Herumdeuten an Einzelzügen überläßt er mit Schmunzeln auch weiterhin den „Mythographen“. Zwei für uns wichtige Ergebnisse haben Schmidts gründliche Untersuchungen. Erstens: Die Sage vom Rothaer Mann ist eine Entstehungssage, wie es deren viele gibt und wie sie sich im benachbarten Siebengemeindewalde gleich noch einmal wiederholt. Brot und Käse sind eine mittelalterliche Lehnsabgabe. Das verlorengegangene Burgfräulein ist ursprünglich weder eine germanische Göttin, nach welcher der Frühlingsgott sucht, noch der Maiprinz, der aus dem Walde eingeholt wird. Zweitens: Ouestenberge gibt es in Deutschland mehrere, in unserer engeren Heimat noch zwei. Es sind Anhöhen, die nicht mit Wald, aber auch nicht allein mit Gras oder Heidekraut bewachsen sind, sondern mit Gestrüpp aller Art.[40] Die Eigenart der Umgebung hat dem Dorfe, der über dem Dorfe stehenden Burg, dem Berge, dem Feste den Namen und dem Kranze die Quasten gegeben. Die beiden am Maikranze befestigten Questen oder Quasten dienen dem Kranze zur besonderen Zierde. Auf dem Ouestenberge läßt sich nichts nachweisen, was mit heidnischem Brauchtum zu tun hätte, wenn auch eine vorhistorische Siedlung oder Wallburg auf ihm wahrscheinlich ist. Was H. Wirth, Marburg, über die von Schmidt eindeutig festgelegten Zeichen auf der Questenburg zusammendeutet, hat mit Recht von Schmidt eine scharfe Abfertigung erfahren. Schmidt beschränkt sich auf eine alle Ueberlieferungen erfassende Untersuchung. Bei der Ausdeutung des Brauchtums auferlegt er sich größte Zurückhaltung; die Auslegung will er seinen „Mythographen“ überlasten. — Uns scheint folgendes Brauchtum vorzuliegen: Das Wesentliche ist allein die Aufrichtung des Kranzes. Dieser Kranz symbolisiert das Sonnenrad. Wir haben im Questenfeste den Rest eines alten schönen Sonnenkultus vor uns. Der bei der Neuanbringung des Sonnenrades vollführte Lärm und die nach der Aufrichtung durch den Kranz gegebenen Schüsse sollen die bösen Dämonen abwehren. Die Questen hängen als Zierrat am Kranze. Daß der Pfingstbaum, wie jeder andere Maibaum auch, einen Lebensbaum darstellen soll, ist selbstverständlich. Auch das Herbeiholen allein mit Hilfe von Menschenkraft und die Entfernung des Ungeziefers durch das Abschälen der Rinde mag herangezogen und mag um unsertwillen in Zusammenhang mit dem Fruchtbarkeits- und Wettergotte Donar gebracht werden. Gänzlich abwegig aber scheint uns die letzte Deutung des Questenfestes zu sein, die K. Th. Weigel gibt, der meint, Kranz und Queste hingen am Lebensbaum. „Wenn nicht das Kränzel, das weibliche Symbol, mit der Quaste (Phallus) als männlichem Symbol am Lebensbaum vereint würden, würde dieser verdorren.“ Zumindest hinsichtlich des Questenfestes möchten wir meinen, daß Weigels Neigung, Urväterbrauch reichlich einseitig auf Fruchtbarkeitszauber zurückzuführen, unangebracht ist.[41]  II. Der Kreis der Mittsommerzeit und der Herbst-Tag- und NachtgleicheMit Pfingsten sind für längere Zeit die rauschenden Feste dahin, wenigstens für die Erwachsenen. Stille wird es im heidnischen, ganz still im christlichen Kreis. Hahne, dem wir sonst nicht überall folgen können, hat eine schöne Erklärung dafür gefunden, warum das christliche Jahr in seiner Erfüllung und Reife so still werde. Ankündigung des Kindes, des Heilandes Geburt, sein Tod, seine Auferstehung sind den Gläubigen Beweise höchster Gottes liebe und Gottesverklärung, dazwischen steht sein Lehren, dem man andächtig lauscht, und sein Wirken, das man fromm zu erleben sucht, und beide, die Lehre und das Werk, regen wieder und wieder Gedanken und Gefühle zum Forschen und zu künstlerischer Darstellung an, aber sie regen nicht an zu sich alljährlich wiederholen dem Brauch. Das vermöchten Ehe und Zeugung, wie sie sonst auf der Höhe menschlichen Lebens natürlich sind; doch diese finden im Leben des Heilandes keine Statt. So fehlt für die Reifezeit des Jahres die Anknüpfung und damit christliches Brauchtum.[42] Für die Germanen war der Sommer die Zeit, wo die Sonne den endgültigen Sieg über die Mächte der Finsternis davongetragen hat und wo sich unter dem Segen des Himmelslichtes alles zur Reife und zum Fruchttragen entfaltet. Nun kann der Mensch eine Zeit lang beschaulich und bequem dahinleben, voll Vertrauen auf des Himmels Güte, und nur hin und wieder mischt sich einige Furcht ein vor der Zerstörungssucht neidischer Gewalten. Neben den Dankopfern an das Himmelsgestirn und die befruchtenden Wässer auf Erden schleichen sich die bangen Fragen ein, ob die Ernte geraten, ob die Kinder gedeihen werden. Der Segen des Himmels wird nirgends mit lautem Jubel und lauter Festlichkeit erwartet, sondern voller Stille und Demut. „In 14 Tagen wird die Ernte beginnen, und es ist hier immer so gewesen, daß man vorher eine Weile ganz still ist, die Menschen und auch die Tiere“, schreibt Ernst Wiechert.[43] Wie überall in unserem Vaterland, so finden wir auch in unserer Heimat den Johannistag voller Geraun davon, wie die Mächte der Finsternis besiegt und zurückgedrängt sind in ihr unterirdisches Reich, wo sie unerlöst und sehnsuchtsvoll schmachten müßen. So kommt es um den Johannistag herum zu den vielen Sagen von der Frau Holle. Die Frau Holle ist nach unserer Auffassung ja ursprünglich ein Wettergeist der vorheroischen Gemeinschaftskultur und gehört an die Seite des Seelenkönigs und Wetterdämons Wote. Wie Wote als Anführer der Abgeschiedenen durch das Wettergewölk braust, so herrscht in den Klüften und Höhlen der Erde, in der Hölle, die Totengöttin Hel oder Holle. Erst später mit der Erhöhung Wotans zum Allvater hat auch Frau Holle Züge der Göttin Frija angenommen und erscheint als Beschützerin des Herdes und hausfraulicher Arbeit. Als urgemanische Toten- und Jahreszeitendämonin ist sie aber zur Mittsommerzeit gänzlich in ihr unterirdisches Reich verbannt und denkt vergeblich auf Erlösung. Den in der Johanniszeit in Wald und Feld herumstreifenden Menschenkindern, jungen Hirten oder Landleuten, erscheint sie wohl als weiße Frau oder als Schlüsseljungfrau, zeigt ihnen köstliche Blumen, führt sie in ihr unterirdisches Reich und hofft den Retter zu finden, der sie aus dem Schattenreiche ans Licht führe. Auch drückt sie wohl den Menschen eine Wünschelrute in die Hand, der sich verborgene Schätze öffnen, wenn die Erlösung gelingt. Aber alle ihre Sehnsucht wird zu Schanden, sie muß unerlöst und ohne Anteil an Freude und Licht weiter schmachten und darben. In diesen gerade in unserer Heimat außerordentlich häufigen Sagen tritt uns wieder und wieder die Wunderblume entgegen, die zu Johannis ihren Kelch erschließt. Und mit ihr blühen alle Blumen der heißen Jahreszeit, nicht zart und sehnsüchtig wie die Blumen des Frühlings, sondern stark duftend, verlangend und verheißend, voller Kräfte und Zauber. Die Rose, die Kamille, der Beifuß, das Johanniskraut sind die Zauberkräuter unserer Heimat, die Krankheiten heilen, vor Hexen schützen, verborgene Schätze erschließen, vor allem zum Liebeszauber gut sind, da man mit ihrer Hilfe, und sei es durch Abzupfen der weißen Kamillenblättchen, die Zukunft erfährt, die so wichtig für Ehe und Ernte. In anderen Gegenden unseres Vaterlandes kennt man sogar neun zauberkräftige Kräuter, die die Mädchen in der Johannisnacht zu einem Kranze zusammenflechten, welchen sie danach, rückwärtsgewandt, solange in einen Baum schleudern, bis er hängen bleibt. Sooft der Wurf mißglückt, soviel Jahre muß die Jungfrau noch auf Ehe und Erfüllung ihres Daseins warten. Es dürfte sich also empfehlen, daß sie mit dem Zauber in früher Jugend beginnt. Doch auch die Jünglinge fragen zu Johannis an, ob ihr Mädchen bereit ist, mit ihnen den Lebensgang zu wagen. Sie haben es freilich einfacher als die armen Mädel, denen sich ein Bursche noch nicht offenbart hat. Denn sie gehen einfach vor das Haus der Liebsten, der sie zu Pfingsten eine Maie gesetzt haben. Hängt ein Thymiankränzlein heraus, dann dürfen sie gern die Frage tun; schaut ihnen ein Distelzweig entgegen, so müssen sie sich wenden und ihr Glück bei einer anderen suchen. Auch im Traum der Johannisnacht sagen höhere Mächte das Schicksal voraus, besonders verkünden sie den Ausfall der Ernte; deshalb muß man auf diesen Traum wohl achten. Selbstverständlich ist Johannis auch ein Wettertag: In Obergebra weiß man, daß nach verregnetem Johannistage die Nüsse taub werden. Und allgemein bekannt als Verkünder der Wetterlage ist ja der Siebenschläfer (27. Juni), der das Wetter sieben Wochen lang bestimmt. Der Flachs, den man an diesem Tage sät, schläft nur sieben Tage in der Erde. Vom Marientage, dem 2. Juli, heißt es, daß Regen an diesem Tage noch sechs Wochen Nässe, also eine verregnete Ernte bedeute. „Wie Maria über den Harz geht, trocken oder naß, so kommt sie wieder“, heißt es in unserer Heimat, und voll Sorge schaute deshalb früher der Bauer am Morgen dieser Wetterlage nach dem Himmel, da sie ihm volle Scheunen oder eine Mißernte bringen konnten. Mehr als heute, wo dem Landmann künstliche Mittel genug zur Verfügung stehen, war er einstmals auf die natürliche Hilfe von Sonnenschein und Regen beim Wachstum angewiesen. Nasses Frühjahr, trockener Sommer waren ihm erwünscht. Also auch auf die Wassergeister kommt es an, daß sie höchstens bis Johannis die Fluten anschwellen lassen und die Wiesen wässern. Viel Schaden können sie stiften, wenn sie zur Unzeit ihre Tätigkeit entfalten. Deshalb haben unsere Vorfahren, — und zwar seit uralten Zeiten, denn bei Baum- und Quellenkulten handelt es sich um Urkulte — um Johannis herum Quellen und Flüssen sicher Opfer dargebracht, auch Menschen, vor allem Kinder als Opfer, weil sie das Zarteste und Reinste sind, was man spenden kann. Kinder werfen noch heute ihre Kränzlein und Sträuße als Opfer in den Quell, um dem Wassergeist zu danken oder ihn zu versöhnen, wie es beim Brunnenfest zu Popperode bei Mühlhausen geschieht.[44] Wenn man den Wassern nicht freiwillig opfert, so holen sie allein, was ihnen zusteht. Die Wipper fordert nach heimatlichem Glauben alljährlich am Johannistage ihr Opfer, Unstrut und Leine bedrohen den Badenden. Der Glaube an die Tücke der Gewässer am Johannistage ist in ganz Deutschland verbreitet und führt überall zu ähnlichem Brauchtum. Dagegen ist uneinheitlich die Verehrung der Sonne in ihrem höchsten Stande, durch die man einen Zauber herbeizwingen will, der die Saaten endgültig heranreifen läßt. In unserer Heimat kennt man nur die Osterfeuer, nicht die Iohannis- feuer, die südlich und östlich von unserer Gegend entzündet werden. Auch das scheint darauf hinzudeuten, daß sie nicht urtümlich germanisch, sondern aus romanisierten Ländern übernommen sind. Dort leuchten auf den Bergen noch einmal die Feuerlein der Menschen als armseliges Abbild der großen gütigen Sonne entgegen, die die Saaten reifen lassen kann und die Viehseuchen ab- wendet. Zutal gerollte Feuerräder sollen wohl mehr die heilsame Kraft der Sonne in die Felder und Siedlungen der Menschen tragen, als andeuten, daß nun allmählich das Jahr sich neigt. In alten Zeiten war es auch Brauch, am Mittsommertage alle Herdfeuer auszulöschen, ein neues Feuer mit Hilfe von zwei in schnelle Umdrehung gesetzten Hölzern zu entfachen und an diesem Mutterfeuer nunmehr alle Feuer neu anzuzünden. Von ähnlichem christlichem Brauch zu Ostern ist schon berichtet. Da unsere Heimat kein Johannisseuer kennt, ist auch keine kultische Handlung, ein Fest oder ein Opfer, an diesem Tage vorhanden. Wohl aber freuen sich die Erwachsenen des langen, warmen Tages und setzen sich in ihre Lauben beim Kerzen- oder Lampionscheine fröhlich zusammen, oder sie machen nach Art der Pfingstfeste einen Ausflug und tanzen unter der Linde, wie es unter der Linde zu Kaltohmfeld geschieht, zu welcher am Johannistage das Jungvolk der umliegenden Dörfer zieht. An manchen Orten, z. B. in Bennungen, war es früher auch üblich, daß die Schenkenpächter, die Pächter des Gemeindebackhauses, der Gemeindeschäfer den Ortsvorstehern eine Mahlzeit gaben, die Hirtenoder Herrenmahlzeit. Für uns aber ist Johannis kein Fest der Erwachsenen, sondern der Kinder. Vom Eichsfelde herab bis zum Kyffhäuser hin ist der Johannistag überall Kindertag. Der Brauch scheint mit dem alten Wasser- und Brunnenopfer zusammenzuhängen. Eins von den Kindern hatte als Opfer dargebracht werden müssen, die anderen, dem Leben geschenkten sind fröhlich und guter Dinge. Damit sie das nötige Geld und die nötigen Speisen zu ihrem Feste zusammenbekommen, machen sich die Kinder schon einige Wochen vor Johannis auf, das Ihre zusammenzubetteln. Je zwei von ihnen nehmen ein rotes Bündchen, halten es einem Vorübergehenden vor und lassen ihn nicht eher weiter, als bis er sich durch eine Gabe gelöst hat. Dieses sogenannte Hemmen war in unserer Heimat früher in den Wochen vor Johannis allgemein üblich, ist aber vielfach behördlich verboten worden, weil es in lästige Bettelei ausartete. In kleinen Orten wie Rüxleben, Crimderode u. a. hat sich aber das Hemmen als Heischegang der Kinder bis in unsere Tage hinein gehalten. Aus diesen Orten ist uns auch das Sprüchlein bekannt, das die Kinder beim Hemmen hersagten: Heut ist der Tag, Heute ist dieses Heischen der Kinder vor oder zu Johannis kaum noch üblich, wohl aber überall zur Hochzeit. Wenn das junge Paar aus der Kirche kommt, wird ihm ein Bändlein vorgehalten, und der Bräutigam muß sich und die Braut durch kleine Spenden lösen. Es ist ein Brauch, der aus rauhe Urvätersitte weist, wo der Mann noch um die Auserwählte kämpfen oder sie aus der Munt des Vaters loskaufen mußte. Am Johannis-Nachmittage fand früher in allen Ortschaften unserer Heimat ein Kinderfest statt. Dazu wurden Blumengewinde über die Straße gehängt oder Ketten von ausgepusteten Eiern gemacht, ein Johannisbaum wurde angeputzt und auf dem Dorfplatze oder vor dem Schulhause aufgestellt. Hier fanden sich die Kinder bei Kaffee und Kuchen zusammen, sangen, spielten, tanzten, die Knaben schössen nach der Scheibe oder dem Vogel, und die Mädchen schlugen den Rosentopf. Dieses Topfschlagen war für das Iohanniskinderfest so charakteristisch, daß es bis auf den heutigen Tag in Nordhausen einfach „Johannis“ oder „Rosentopf“ heißt. Ein umgestülpter Blumentopf nämlich barg allerlei kleine Geschenke, die das Mädchen erbeutete, das mit verbundenen Augen und mit höchstens drei Schlägen den Topf traf. Ursprünglich gehörten unter den Topf freilich keine gleichgültigen Gaben, sondern ein Hahn, und erwachsene Dirnen schlugen danach, verunstalteten das „Hahnenschlagen“, wie es hie und da in Deutschland noch heute Brauch ist. Der Hahn aber ist das Sinnbild des verzehrenden, verderblichen Feuers, es ist der „rote“ Hahn. Auch kannte der germanische Mythos den rostbraunen Hahn neben dem Höllenhund Garmr als Tier der Unterwelt. Bei der Deutung unseres alten Brauchtums ist es kaum beachtet, daß hier derselbe Gedanke wie bei den Sagen um die Frau Holle zugrunde liegt. Die Kräfte der Hölle, der Finsternis suchen wohl selbst zur Zeit des höchsten Sonnenstandes emporzudringen, werden aber erschlagen. In den Dörfern am Kyffhäuser fand das Hahnenschlagen der jungen Mädchen einstmals Johannis statt, in anderen Dörfern unserer Heimat zu Michaelis oder zur Kirmeß. Auch die Rose und der Rosentopf haben ihre Bedeutung. Neben dem zaubergewaltigen Johanniskraut ist die Rose die Blume der sommerlichen Hochzeit. Sie symbolisiert die Sonne in ihrem höchsten Glänze, und der Topf dieser Blume deckt völlig den Hahn, den Geist der Unterwelt. Während die Mägdlein bei ihrem Feste den Rosentops schlagen, schießen die Knaben mit der Armbrust oder dem Pusterohr nach der Scheibe oder dem Vogel, der Flatterscheibe. Merkwürdig, daß unsere heimatlichen Dörfer diese Begehung des Johannisfestes kaum noch kennen, daß es dagegen in Nordhausen bis auf den heutigen Tag, wenn auch nicht mehr als großes Gemeinschaftsfest, so doch in kleinen Kreisen mit Anputz einer Maie und Topfschlagen begangen wird. Bis zur Zeit des großen Krieges bestand in Nordhausen auch die schöne Sitte, daß das Waisenhaus am Johannistage ein großes Kinderfest mit Rosentopsschlagen der Mädchen und Pusterohrschießen der Knaben verunstaltete. Jedes Kind erhielt ein Geschenk. Der beste Schütze aber wurde Schützenkönig und durfte bei dem Umzüge durch die Stadt, der vor das Haus des Bürgermeisters als des Protektors des Waisenhauses ging, den Johanniskranz vor der Kinderschar hertragen. Am Abend bewirtete die Stadt ihre Waisen dann noch mit einem Abendessen, mit Bratwurst und Kartoffeln. Aehnlich wie in Nordhausen der Schützenkönig, so trugen auch in Roßla die Kinder zu Johannis einen grünen Busch herum, der mit Ketten und Eierschalen, Blumen und Bändern geschmückt war. In manchen Orten, z. B. in Stockhausen, Sundhausen, Stolberg war Johannis ein Fest, das die Kinder um die Maie versammelte. In anderen Orten wieder, wie z. B. in Groß-Werther, fällt den Mädchen ein, daß sie sich gerade am Johannistage auf die Schaukel setzen müssen, ein in Deutschland weit verbreiteter Brauch, der aber bei der Dürftigkeit der Ueberlieferung und der ungenügenden Vergleichsmöglichkeit jedem Deutungsversuch spottet.[45] Nun lastet Sonnenglut mehr und mehr über den Feldern. Der Landmann hat das Seine getan, die Saat zum Aufgehen und zur Reife zu bringen; jetzt kann er nichts weiter tun als warten und den Wettergottheiten vertrauen. So verrinnt ihm die Zeit bequem und still; doch wird die Beschaulichkeit wieder und wieder gestört durch Hoffen und Sorgen. Es ist eine Zeit zum Grübeln und Denken. Und der menschliche Geist, so viel Neues er auch im Laufe der Jahrtausende erdacht hat, so ähnlich ist er sich doch in den Grundformen seines Sinnens geblieben. Das Zweifeln und Wissen, Ahnen und Fühlen des Bauern heute ist noch dasselbe wie das jener Urgeschlechter, die in der Bronzezeit germanischen Ackerbau und germanische Viehzucht gegründet und die agrarische Religion geschaffen haben. Es ist durchaus eine Gemeinschaftsreligion, aber nicht mehr primitiver Art, sondern schon belebt und beseelt sie phantasievoll die ganze Natur mit Naturgeistern, diese allerdings räumlich und zeitlich beschränkt gedacht, nicht ewig wie die späteren Götter. Diese Geister stehen ferner in mancherlei Beziehung zu den Menschen, stellen aber noch keine sittlichen Forderungen an sie wie die Unsterblichen. Es sind nicht mehr die Dämonen des steinzeitlichen Menschen, in denen die Toten fortleben und den Menschen quälen, sondern sie leben und weben, nunmehr schon ohne Zusammenhang mit den Abgeschiedenen, überall in der Natur, doch weniger zum Nutzen als zum Schaden, woran man noch ihren Ursprung aus dumpfem Totenglauben erkennen kann. So sehr sich menschliche Vorstellung von diesem ursprünglichen Geisterglauben entfernt hat, — die Geister gehen doch noch heute um: Der Roggenwolf, der in Groß-Furra durchs Korn geht, oder die Wölfe und Säue, die in Rodishain die heranreifenden Gefilde unsicher machen, oder die wilden Schweine, wie sie in den meisten Dörfern unserer Heimat in den hohen Saaten gedacht werden. Auch der Kornstutzer von Groß-Wechsungen, der Kornbock von Pützlingen oder der Johannisschnitter von Werna und Sülzhayn sind Erntedämonen in Tiergestalt,[46] oder es ist die Mittagsfrau, die im wabernden Leben der Mittagsglut auftaucht und die bei uns mit der Frau Holle identisch ist. Meist verbindet man irgendein Unheil mit diesen Vegetationsdämonen. Wer sie sieht, muß sterben oder erblindet oder fällt in jahrelange Krankheit. Doch legt man, auf etwas höherer Stufe, diesen Geistern auch schon ethischen Gehalt bei. Der Johannisschnitter, die Frau Holle warnen die Kinder, während der Reifezeit in die Halme zu gehen, und bedrohen sie, wenn sie es tun, um Kornblumen oder roten Mohn zu pflücken. Hier liegt schon der Uebergang vor von einfachen Dämonen zu höher begriffenen Geistern, welche die agrarwirtschaftliche Religion der späteren Bronzezeit geschaffen hat und die der Ursprung der seligen, friedlichen Wanengötter Njörd und Freyr sind Und nun steht die volle Aehre als Lohn für die Mühe auf gelbem Halm. Gut ist geraten, was man einst zur rechten Zeit unter Anrufen der Gottheiten gesät.[47] Auch alle Gebräuche bei der Aussaat sind richtig innegehalten, insbesondere bei der Saat des einst so wichtigen Flachses. Der rankeste Bursch hat ihn gesät und hat alsdann einen hohen Sprung getan; denn so hoch man springen kann, so hoch wächst der Flachs, und schön lang wird die Faser. Dieser Glaube galt einst ganz allgemein und ist zuletzt noch aus Mörbach auf uns gekommen. Wo kein schneidiger Jungkerl zur Stelle ist und der Bauer selbst die Saat besorgen muß, hat er doch nicht vergessen, sobald der Same aus dem Sacke ins Sätuch gefaßt ist, den leeren Sack in die Höhe zu werfen, damit der Flachs ansehnliche Höhe erreiche. Bei uns gilt allgemein der 25. Juli, der Jakobstag, als Erntebeginn, im Magdeburger Land der Margaretentag, der 13. Juli; am Lorenztage, dem 10. August oder bei uns am Bartholomäustage, dem 24. August soll die Ernte beendet sein.[48] Diese vierwöchige Erntezeit ist eine Zeit ernster, würdiger Arbeit ohne Hast und Gelärm, ohne Fackel und Feier. Wie der Sämann einst mit sorgender, gelassener Hand die Körner in der Erde Schoß gesenkt, so waltet jetzt gelassen und fromm der Schnitter seines Amts. Aussaat und Ernte sind Gottesdienst.[49] Der Vormäher hieß früher bei uns, z. B. in Groß-Furra, der Stoppelvogt. Die erste Garbenfuhre brächte der Bauer selbst ein mit den aus Liebenrode bezeugten Worten: „Hier bringe ich den Mäusen etwas zu saufen und nicht zu fressen. Im Namen Gottes …“ Damit versuchte er einen ähnlichen Ungezieferzauber zu üben wie einst im Frühjahr, wo er das Gewürm und alle Nager herausklopfte, sehr nötig in jenen Zeiten, die noch keine Chemikalien und Bazillen kannten, sondern sich mit Fallen und Katzen allein gegen das Ueberwuchern des Ungeziefers zu retten wußten. Vor dem Schnitter her flüchten die Vegetationsdämonen, die sich im Korne aufgehalten haben. Solche Dämonen niederer Art sind die Wölfe oder Hasen, die aus dem letzten Strich stehen- gebliebener Halme davonlaufen. So sagt man von dem Mäher, der in Bennungen das letzte abhaut: „Er hat den Wolf“. „Er jagt den Hasen heraus“, heißt es in Sollstedt und Wülfingerode; „er hat den Hasen“, sagt man in Sülzhayn. Und diesen Hasen, der entweder entweicht oder mit dem letzten Sensenschwung sterben muß, kennt man beinah in jedem Dorfe unserer Heimat noch heute.[50] Eine Zeit mit höheren Geistervorstellungen, aber offenbar noch nicht mit Göttervorstellungen schuf zu diesen einstigen Totendämonen einen Anführer, den Wote. Von ihm heißt es nicht mehr, daß er mit der letzten Aehre sterben müsse, oder daß er sich nach abgehauenem Felde auf und davon mache, bei ihm ist nicht mehr ein Leib in einen anderen eingegangen, der Leib eines toten Menschen in einen Wolf oder einen Hasen, sondern hier waltet schon ein Wesen, das man sich natürlich noch leiblich vorstellt, das aber doch nicht zu fassen ist, weil es schon mit überirdischen Kräften begabt ist. Dieser Geist stirbt nicht, sondern ist ewig da mit seinem Zorn oder seiner Gnade, und neben den männlichen Geist tritt auch ein weiblicher, die Frau Holle. Beide faßt man nicht mehr robust an, fängt sie nicht oder treibt sie aus, sondern verehrt sie voll Furcht, voll Demut, voll Dankbarkeit und bringt ihnen von den letzten Aehren des Feldes ein Opfer. In früheren Jahrhunderten brächte man dem Wote feierlich das Dankopfer dar, ließ ein Büschel Getreide stehen, umband es mit Aehren und Feldblumen, besprengte es mit Master oder Bier. Dann zogen die Schnitter die Hüte ab, schwangen die Sensen empor und riefen dreimal: „Wöbe, hol deinem Rosse Futter!“[51] Vereinfacht ist dieser Brauch in unserer Heimat bis auf unsere Tage lebendig geblieben von Bennungen im Osten bis auf das Eichsfeld im Westen: In Bennungen ließ man drei Aehren für Wote stehen, in Teistungen drei für Frau Holle. Und noch heute kommt es bei Kelbra vor, daß beim Binden der letzten Garbe oder beim Aufstellen der letzten Mandel die Schnitter rufen: „Oller Mann ho!“ Der Alte aber ist Wote.[52] Während der langen und schweren Arbeit auf dem Felde muß man nun aber auch schon darauf denken, sich von den Anstrengungen zu erholen und die nötigen Mittel zu den Feierlichkeiten bereitzuhalten. So machen es die erwachsenen kornmähenden Knechte und garbenbindenden Mägde auf dem Felde genau so wie die Kinder vor dem Johannistage. Dem „Hemmen“ der Kinder entspricht das „Anbinden“ der Feldarbeiter. Betritt der Eigentümer oder Gutsinspektor oder ein Fremder das eben abgeerntete Feld, über das noch nicht die „Hungerharke“ oder „Sausterpe“ gegangen ist, so wird er gebunden, eine Sitte, die in unserer Heimat noch vielfach üblich ist.[53] Der Brauch geht im allgemeinen so vor sich, daß man dem zu Bindenden ein Schleifchen an den Aermel heftet als Symbolseiner Unfreiheit, aus der er sich mit einer Gabe lösen muß. Die Sitte ist also nichts als ein Gabenheischen für ein künftiges Fest. Nicht fetten erinnert man den Bauern auch an seine Pflicht, inde Aehren ein kleines Kränzlein winden, an das sie zur Zierde noch ein Feldblumensträußchen befestigen. Dieses Kränzlein überreichen sie zu guter Stunde dem Bauern und sprechen gewissermaßen durch die „Blume“ oder hier durch die „Aehre“ zu ihm. So geschieht es in Pützlingen und anderswo.  Verse werden bei diesen Bräuchen kaum noch gesprochen. Aus Liebenrode und Sollstedt ist uns folgender Spruch überkommen: „Als ich morgens früh aufstand, Auf der Hainleite und dem Dün, in Groß-Brüchter und in Keula, heißt es folgendermaßen: Diese Nacht lag ich und schlief, Oder ähnlich: „Heut ist der Tag, Das Einbringen des letzten Fuders ging früher feierlicher von statten als heute. Auf ihm stand der Erntekranz, der aus Aehren der letzten Garben angefertigt und mit Blumen und bunten Bändern geschmückt war. Der Fuhrmann des letzten Wagens bekam eine kleine Gabe, etwa ein Taschentuch, geschenkt. Am Abend setzten sich Knechte und Mägde zu festlichem Mahl. In Lipprechterode sagte man beim Einbringen der Ernte folgenden Spruch her: „Jetzt kommen wir mit unserm Heer, So manches gute Jahr, so manches Korn wünschen wir dem Herrn und der Frau in die Kasten. Heute geht es weniger feierlich zu; doch ist es noch überall üblich, daß man auf das letzte Fuder den Erntekranz stellt, einen Kranz, der möglichst alle Früchte des Feldes enthält und den eine kleine Sense und Harke, über Kreuz gelegt, überragen. Meist ist er auch mit Bändern, Flittern, ausgepusteten Eiern geschmückt. Die eigentliche Feier aber spart man für das Erntedankfest und vor allem für die Kirmeß auf. Der Erntekranz wird auch heute noch das ganze Jahr über aufbewahrt und in Ehren gehalten. Kaum ist es, da heute die Dreschmaschinen die Arbeit übernommen haben, noch üblich, den Dreschern nach beendetem Drusch mit Mahlzeiten aufzuwarten, wie sie als Flegelmahlzeiten, dialektisch Fleilmohlst oder Fleilassen, früher bekannt waren. Natürlich kennt man auch das Schutzspiel oder Schutzspül nicht mehr, das der Herr den Dreschern gab, wenn sie einen Teil der Scheune ausgedroschen hatten.[54]  Doch noch ist nicht so recht eigentlich die Zeit für Feiern und Gastereien gekommen. Michaelis naht und damit mancherlei Abgabe, die dem sparsamen Bauern nicht ganz nach dem Sinn ist. Pachtgelder müssen bezahlt, Zinshühner mußten einstmals abgeliefert werden. Auch durfte man nicht bloß an die Behörden oder den Besitzer denken, sondern auch an den Pfarrer, den Kantor, den Gemeindediener. Auch diese mußten zu Michaelis bedacht werden mit Getreide, Hülsenfrüchten, Gänsen, Hühnern und dem Michaelisgroschen. Es waren so mancherlei Verpflichtungen, denen man nachkommen mußte, nicht nur, wie es in einem alten Nordhäuser Statut heißt, pro fisco, sondern vor allem auch pro Christo.[55] Schon diese Abgaben bedrückten knausrige Gemüter, aber auch die Jahreszeit, an die man sich erst gewöhnen muß. Die Tage sind kürzer geworden, die Bäume entlauben sich, ein harscher Wind fegt über die Stoppeln; man muß an den Ofen denken und an die Spinnstuben.[56] Draußen treiben die Fäden des Altweibersommers; es sind die Gespinste der Schicksalsgöttinnen, der Nornen. Bleibt ein Faden am Gewände hängen, so bedeutet das Glück. Der christliche St. Michael, der tapfere Held, der kein anderer ist als der alte Donar, ursprünglich der Gott der Fruchtbarkeit, ist zwar ein wackerer Streiter, aber es ist schon ein schweres Ringen mit den heranbrausenden Todesgottheiten, dem Herrn Wote und der Frau Holle, die in den Tagen der Tag- und Nachtgleiche zum ersten Male mit ihrem wilden Heere durch die Lüste brausen. Deshalb verknüpften die Germanen mit dem Erntedankfest ein ernstes Totengedächtnisfest, an dem sie den Abgeschiedenen ein Sühneopfer brachten, da von der Gunst der gefürchteten Toten der Wohlstand abhing. Beim Ausruhen von der Arbeit und beim Anblick all der guten Gaben, die die Ernte beschert hat, wurde auch in stiller Wehmut der Toten gedacht, die nicht mehr mitgenießen können und die deshalb vielleicht gar neidisch sind. So wird Wote, der Totengott, neben Donar, dem Fruchtbarkeitsgotte, gefeiert. Auf Donar zielte das früher zu Michaelis oder zur Kirmeß veranstaltete Hammelreiten und Hahnenschlagen. Beides am gleichen Tage ist heute kaum noch im Brauch; wir können es nur noch von Rehungen nachweisen, wo das Hammelrennen und Hahnenschlagen jetzt am zweiten Kirmeßtage stattfindet. Ueber die Bedeutung des Hahnenschlagens, wobei der Hahn das Sinnbild der Welt der Abgeschiedenen ist, haben wir uns schon oben verbreitet. Der Hahn ist neben der Gans allerdings auch ein Symbol der Fruchtbarkeit und als solcher dem Donar geweiht. Das Hammelreiten oder -laufen aber findet zu Ehren Donars statt, dem der gehörnte Bock geweiht ist. Noch vor wenigen Jahrzehnten ging das Hammelreiten so vor sich, daß die wohlhabenden Burschen des Dorfes sich auf ihre festlich herausgeputzten Pferde setzten, dem Schäfer einen Hammel abkauften und dem Schäfer samt seinem bändergeschmückten Hammel durchs Dorf auf das Feld folgten. Hier war auf einer Stange ein Kranz befestigt, nach welchem um die Wette geritten wurde. Wer dreimal zuerst angekommen war und ihn heruntergerissen hatte, bekam den Hammel. Dieser wurde dann ins Dorf zurückgeführt und mußte schleunigst geschlachtet und gehäutet werden. Die ganze Verrichtung durfte nicht länger dauern, als die Dorfmusik zwei Stücke spielte. Zum festlichen Hammelbraten mußte der Sieger den Trunk zum besten geben. Wo man, wie etwa in Rüxleben oder Furra oder Rüdigershagen, nicht so wohlhabend war, daß sich viele Bauern Pferde halten konnten, fuhren die Burschen auf geschmückten Bauernwagen aufs Feld und liefen hier nach dem Kranze, statt zu reiten. Das ist das „Hammelrennen“, bei dem von allen Mitspielenden nur einer den Preis erringen kann, eine Bezeichnung, die von diesem Brauche auch auf das Kartenspiel übertragen worden ist. Uebrigens war es hie und da, z. B. in Jechaburg, Sitte, dem Bock einen Spiegel an oder unter dem Schwänze zu befestigen, eine Maßnahme, die auf einen alten Abwehrzauber zurückgeht. Heute findet das Fest noch in Rehungen zur Kirmeß in einfachster Form statt: Man läßt einen Hammel laufen, und jeder sucht ihn zu haschen. Bei uns hat sich das kirchliche Erntedankfest um Michaelis herum als Volksfest nicht eingebürgert; es wird als Kirmeß oder Martinsfest erst im Oktober (Gilbhart) oder im November (Nebelung) begangen. Bei dieser Kirmeß ragt ja auch das Christentum herein. Sehr glücklich hat es die Weihe der heimatlichen Kirche mit dem Erntefest in Verbindung gebracht. Der Jahrestag der Kirchweih, der Kirchmesse, des Dankes für das Gotteshaus wurde mit dem Danke für den Erntesegen verbunden. Deshalb ist es zur Kirmeß auch so gut wie in allen heimatlichen Dörfern Brauch, am Sonntag morgen beim Gottesdienste der Gründung der Ortskirche zu gedenken, am Montag morgen aber in der mit den Früchten des Feldes geschmückten Kirche den Dankgottesdienst zu begehen. Sonst hat diese Kirmeß aber durchaus weltliche Formen und stellt sich so recht als ein Fest des erntefrohen Bauerntums dar. In unserer Heimat ist die Kirmeß eigentlich das weltliche Hauptfest des Jahres, dessen Termin große Gruppen von zusammenliegenden Ortschaften für jedes einzelne Dorf einheitlich festlegen, damit während des ganzen Gilbhart und bis tief hinein in den Nebelung an jedem Sonntage ein anderes Dorf die Kirmeß begeht und die Bauernschaften sich untereinander besuchen und dadurch möglichst oft feiern können. Für die Vorbereitung und Ausgestaltung des Festes und für die Ordnung während des Festes sind einige Burschen verantwortlich, die man fast allenthalben Dingeburschen nennt, in Bischofferode heißen sie auch Platzmeister, in Stockhausen Kirmeß- burschen. Und wenn diese Dingeburschen nun genügend das Fest vorbereitet haben, kann das Schmausen und Tanzen und Ausgelassensein nach Herzenslust beginnen. Am 2. oder 3. Kirmeß- tage zieht der Erbsbär durch das Dorf, heute leider fast ausschließlich ein Heischegang der Burschen, um Geld und Gaben zu erbitten, die Kirmeß weiter feiern zu können. Tatsächlich steckte ursprünglich mancherlei Sinn hinter den vermummten Gestalten. Im Mittelpunkte stehen die beiden Bären mit dem Bärenführer. Die Bären sind mit Erbsstroh umkleidete Jünglinge mit einer Maske oder Verkleidung vor dem Gesichte, die Anspruch erhebt, einigermaßen dem Haupte eines Bären ähnlich zu sehen. Die Bären stellten einst den Winter vor, der im Februar zum Gespött der Dorfbewohner herumgesührt wurde, da sich seine Herrschaft dem Ende zuneigte.  Ueberhaupt war es bei unseren Vorfahren allgemein beliebt, bei Festen und Aufzügen in Tiermasken auszutreten. Mit den Tieren lebte man, freute sich ihrer Kraft, ihrer ihrer Klugheit, ihrer Treue und wünschte sich selbst wohl die eine oder andere Eigenschaft eines Tieres. In Tiere dachte man sich auch die Seelen Verstorbener eingegangen, deren Hauptcharakterzug vielleicht an den eines Tieres anklang, an den Stolz und die Schnelligkeit des Hirsches, die Treue des Hundes, die Gier des Wolfes, die Ungeschlachtheit des Bären. Wenn man sich eine Tiermaske aufstülpte, erhielt man die Eigenschaft des Tieres, auch konnte man wohl mit der Furchtbarkeit der Tiergestalt böse Dämonen schrecken. Dergleichen Vorstellungen führten zu der Annahme von Tiermasken. Heute wollen die Erbsbären nur noch durch ihr tapsiges Benehmen Aufsehen erregen, und da der alte Sinn verloren gegangen ist, wohl aber zuweilen noch Zigeuner als Bärenführer durch die Orte ziehen und ihre Tiere Späße machen lassen, wird das Gebühren dieser Gaukler nachgeahmt. Deshalb sind die Bären auch häufig umschwärmt von als Zigeunerkinder verkleideten Dorfjungen, welche die Aufgabe haben, die Gaben einzusammeln. Dazu kommen noch ein paar weitere wichtige Personen, deren eigentliche Wesensart heute unbekannt geworden ist, die aber dem Zuge des Erbsbären auch heute nicht fehlen dürfen; wenigstens die äußere Ausgestaltung hat man einigermaßen treu bewahrt. Es sind in erster Linie der Baias, der wie beim Fastnachtszuge seine Späße macht, mit der Schellenkappe auf dem Haupte und mit der Pritsche bewehrt. Er hat ursprünglich die Aufgabe durch Lärm und Schellengeläut und Pritschengeklatsch die Dämonen zu vertreiben. Neben ihm steht auch heute noch der schwarze Mann, der Essenkehrer mit dem Rußtopf, der die Vorübergehenden, vor allem die Mädchen, schwärzt, ein Brauch, heute nur als Scherz geübt, einstmals voll tiefen Sinns; sollte doch die Schwärze die Menschen den bösen Geistern unkenntlich machen und ihnen Glück bringen. Mitternachts am zweiten Kirmeßtage wird auch heute noch in den meisten Orten die Kirmeß begraben. Auf einem Schrägen oder einer Leiter wird ein Bursche hereingetragen, der die tote Kirmeß vorstellt. Pastor, Leidtragende, der Kantor mit seinen Kindern dürsen dem Zuge nicht fehlen. Die tote Kirmeß wird in einen Backtrog gelegt und zugedeckt, während alle Anwesenden in Wehmut zerfließen. Dann tritt ein Dingebursch, als Pfarrer verkleidet, vor und hält eine gewichtige Leichenpredigt. Zuweilen besteht diese Rede nur in einem farblosen Lob auf die Kirmeß, häufig aber läßt sie einen wesentlichen Lharakterzug der Germanen erkennen. Der Germane ist geneigt, sich ständig ehrlich und ernsthaft über sein eigenes Tun und das seiner Mitmenschen Rechenschaft zu geben; sorgen, zweifeln, sich prüfen, kritisieren zeugt von einem Zuge zur Gründlichkeit und zur Gerechtigkeit, wenig ist dem echten Germanen mehr verhaßt als Oberflächlichkeit und Eigenlob. Aus dieser Wesensart heraus ist er geneigt, bei festlichem Begängnis in heiterer Weise darzutun, wie er sich selbst und seine Umwelt sieht. So wird in der Leichenpredigt der Kirmeß Gericht gehalten über alle Personen, die im letzten Jahre hervorgetreten sind, und über alle Ereignisse, die Aussehen erregt haben. Da wird keiner geschont, von der hohen Dorfobrigkeit und dem Herrn Pastor angefangen bis herab zum sechzehnjährigen Burschen, der zum ersten Male ungeschickt genug vor seiner Liebsten Haus geschlichen. Ost dehnt sich die Kirmeß auch noch über einen dritten Tag aus. Früher fand an diesem Tage gern das schon oben erwähnte Hammelrennen der Burschen und Hahnenschlagen der Mädel statt.[57] Die Nordhäuser Kirmeß fand einst am Martinstage, dem 11. November statt. Doch hat man diese Martinsfeier seit der Reformation zu Ehren Martin Luthers auf den 10. November verlegt. Mit der Kirmeßfeier ist nun die Feier des Geburtstages Luthers und der Reformation verknüpft. Deshalb wird auch der Tag des Thesenanschlages, der 31. Oktober in Nordhaufen nicht festlich begangen. Auch bei diesem Feste ist also eine heidnische Feier mit einer christlichen verbunden worden, doch ist das heidnische Erntedankfest derart durch das christliche Begängnis verdunkelt worden, daß für den Uneingeweihten kaum noch alte Züge zu entdecken sind. Und doch klingt die Vorzeit auch beim Martinsfeste noch herüber in unsere Tage. Zunächst sind St. Martin und Wote identisch. Martin ist in der christlichen Legende der Reiter mit dem Mantel. Das ist aber kein anderer als der heidnische Hackelberndt, heute im Harze entstellt Hackelberg genannt, und das heißt der Mantelträger.[58] Unter diesem Hackelberndt verbirgt sich der heidnische Wotan, der aus einem Schimmel in langwallendem Mantel durch das Sturmgewölk fährt. Im Verse aber heißt es: „St. Martin kommt nach alten Sitten Auch die Sitte, zu Martini am Rheine Martinsfeuer anzuzünden, bei uns Laternen, mit denen die Kinder durch die Straßen ziehen, oder bunte Martinskerzen, die beim Martins- schmause brennen, weist auf das alte Herbstopferfest hin, bei dem die Lichter entzündet wurden zum Dank für die Gottheit, welche die Ernte beschert hat: „Herr Martin kommt, der brave Mann, heißt es bei uns. Oder in anderer Fassung: „Martin ist ein braver Mann, Manche Forscher glauben auch, daß die Gans, die zu Martini in vielen Lausenden Exemplaren ihr Leben lasten muß, seit alters Wotan geheiligt gewesen sei und deshalb an diesem Wotansfeste gegessen werde. Die Gans ist aber eher dem Donar oder dem Freyr als Fruchtbarteitsgottheiten geweiht, was freilich noch nicht gegen das Gansessen als heidnischen Brauch spricht, da beim Erntefeste sehr wohl zunächst Donar verehrt sein kann, der dann durch den Totengott Wotan verdrängt worden ist. Und wie eng Erntedankfeste und Totenfeiern Zusammenhängen, haben wir ja schon gesehen und werden es noch weiter sehen. Doch möchten wir meinen, man solle die Dinge nicht pressen und lieber annehmen, daß zu Martini deshalb so viele Gänse geopfert werden, weil dann gerade ihre Zeit gekommen ist und sie in Flaum und Fett die rechte Fülle zeigen. Ein uralter Aberglaube ist auch mit dem Gansessen verbunden: Erscheint, wenn man die Gänsebrust zum leckeren Male gelöst hat, das Brustbein dunkel, so gibts einen milden Winter, erscheint es hell, so bringt er Frost und Eis. So wird uns in Liebenrode und vielen anderen Orten erzählt.[59] Heute ist heidnische Erntedanksestsitte ganz überdeckt von christlichem Brauch. Schon im 9. Jahrhundert erließ der Erzbischof von Mainz ein Edikt für seine ganze Diözese, das Martinsfest zu feiern. Zu Mainz aber gehörte auch das Archidiakonat Jechaburg und zu diesem unsere Heimat. Seit 1171 ist der Brauch des Gänseschmauses zu Martini nachweisbar. Das Martinsfest ist also, weil unsere Heimat unter der kirchlichen Aufsicht von Mainz stand, von Westen, von Franken her zu uns gekommen im Gegensatz zum übrigen Brauchtum, das beinahe ausschließlich nach Norden, insbesondere nach Sachsen weist. Kulturpolitisch und, fügen wir hinzu, seit dem ausgehenden Mittelalter wirtschaftspolitisch sind die mitteldeutschen Lande zwischen Harz und Hainleite mehr von Sachsen beeinflußt als von Franken; nicht der Südrand des Harzes ist die Grenze nach Thüringen hin, sondern der lange Zug des Dün und der Hainleite mit ihrem scharfen Steilabfall nach Norden hin. Besonders in Nordhausen, wo der Wohlstand der Bevölkerung es seit alter Zeit gestattete, ist das Martinsfest zu einem rechten Kirmeßschmause ausgestaltet, bei dem vielfach zu dem fetten Vogel, der Gans, noch der fette Fisch, der Karpfen oder die Schleie, tritt. Das Bekenntnis der alten Freien Reichsstadt zur Reformation erscheint dadurch, daß man den alten heidnischen Kerzen ausgiebig die Bilder von Martin Luther und seinem Mitarbeiter Justus Jonas, einem geborenen Nordhäuser, aufdrückt und mit diesen bunten Lichtern den Martinstisch schmückt. Wie alle diese Bräuche Jahrhunderte alt sind, so auch der, am Martinstage wie zu Michaelis den Pfarrern und Lehrern ihre Zinsen und Geschenke darzubringen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es luftig anzusehen, wenn die Schüler frühmorgens am Martinstage, mit Gänsen, Karpfen, Torten, Wein und Kerzen schwer bepackt, in die Schule zogen, um ihre Lehrer zu bedenken. — Am Martinstage wechselte auch das Gesinde; die abziehenden Knechte und Mägde bekamen noch einen Schmaus und, ehe sie sich trollten, die Trollbrezel. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist in Nordhausen die Martinsfeier dadurch ein öffentliches Volksfest mit geistlichem Einschlag geworden, daß die Einwohner sich zu einem Zuge durch die Straßen zusammenfinden. Heute endet dieser Festzug auf dem Lutherplatze mit einem Bekenntnis zum Lutherschen Glauben und mit dem Absingen des Lutherliedes. Durch alle diese Veranstaltungen aber ist den Nordhäusern ihr Martinsfest so teuer geworden, daß sie es auch in der Fremde nicht vergessen können. Wo draußen, fern der Heimat, Nordhäuser weilen, da finden sie sich zum Martinsfest zusammen und begehen es, wie sie es in der Heimat geübt. „Wes das Herz voll ist, des fließt der Mund über“, übersetzt unser teurer Martin Luther, und so hat denn die Nordhäuser Martinifeier auch dichterische, wir wollen nicht sagen, Verklärung, aber Bearbeitung gefunden. In den „Nordhüschen Riemen und Bittern“ wird auch vom „Märtensobend zu Nordhusen“ gesungen; die bezeichnendsten Strophen des Gedichts mögen hier folgen: „Wär freit sich nicht, wänn zu Märtin Schon mehrfach haben wir gesehen, daß die Erntedankfeste im Herbste zugleich Gedächtnisseiern für die Toten sind. Der November, der Nebelung, der Monat, in dem alle Natur abgestorben ist, ist auch für den Menschen der Totenmonat. Wenn die christliche Kirche in den November ihre Totenfeste gelegt hat, so ist sie damit nur uraltem Brauche gefolgt. Allerheiligen und Allerseelen sind die größten und schönsten Feiern der armen in Qualen schmachtenden Seelen, die für diesen Tag aus dem Fegfeuer entlassen werden und auf Erden weilen dürfen. In der Allerseelennacht begehen die Verstorbenen ihre Andacht in den Kirchen und lauschen den Worten ihrer verstorbenen Pfarrer. Während wir nun nicht selten feststellen konnten, daß alter schöner, unserer Natur gemäßer heidnischer Brauch vom Christentum verdrängt oder derart umgebogen worden ist, daß kaum noch die einstmals sinnvolle Begehung erkennbar ist, stehen wir hier, bei den Totenfesten, im Gegensatz zu manchen Altertumsforschern, nicht an, anzuerkennen, daß christliche Auffassung sich hoch über altheidnische erhebt. Auch für den Germanen stieg im Gilbhart und Nebelung alles Gewesene empor und ward im Gedächtnis der Lebenden besonders lebendig. Doch haben unsere heidnischen Vorfahren für ihre Toten vielleicht ein prunkvolles Begräbnis, aber sonst nicht viel mehr als Scheu und Furcht und ängstliche Verehrung aufgebracht; all ihr Brauch und Opfer weisen darauf hin. Erst das Christentum lehrte die Verklärung der Abgeschiedenen im Lichte und erzog die Menschen, der Toten mit liebender Wehmut und mit gläubiger Hoffnung auf das einstige Wiedersehen zu gedenken. Demgegenüber ist der heidnische Germane eigentlich nur wenig über steinzeitliche Furcht herausgekommen. Nach dem Glauben der Steinzeitmenschen lebt der Tote weiter und zwar körperlich in Gestalt von Tieren oder Dämonen, und bis auf unsere Tage ist es einfachen Menschen nicht möglich, sich ein Fortleben nach dem Tode anders als körperlich zu denken. Selbst das Christentum nimmt ja da eine vermittelnde Stellung ein, wenn es die Wiedergeburt im Geiste lehrt, aber doch an der fleischlichen Auserstehung Christi festhält. Nach altheidnischer Anschauung muß der in irgendeiner Gestalt weiterlebende Tote hämisch und neidisch sein auf die noch im Lichte Atmenden. Damit sie nun ihren Neid die Menschen nicht fühlen ließen, brächte man ihnen Opfer dar. Zum Opfer aber gehört auch immer der opferliche Schmaus. Doch die fröhliche Festlichkeit war womöglich ein neuer Anlaß zum Neid des Verblichenen, und so dachte man sie anwesend beim Mahle und glaubte sie besonders zu ehren, wenn man gehörig aß und ihnen Minne zutrank, d. h. zu ihrem Gedächtnis trank. Auf höherer Stufe, als man schon ewige Götter dachte, opferte man zum Totenfeste dem hohen indogermanischen Gotte Tiwas, dem Herrn über die Lebenden und die Toten, und später dem bei den Germanen an seine Stelle tretenden Wotan und seiner Gemahlin Frija. Dem Wotan wurden Rosse, Rinder, Hunde dargebracht, der Frija Kühe und Schweine. Böcke, Hähne, Gänse waren ausgeschlossen, denn sie waren dem Donar heilige Tiere und wurden deshalb zu Michaelis und zur Kirmeß als Dank für die Ernte geopfert. Wenn man aber die Tiere geschlachtet hatte, dann als man von ihnen, um des Segens des Opfers teilhaftig zu werden, um gewissermaßen eins zu werden mit dem Gotte, wie es auf höchster Stufe und Verklärung noch das heilige Abendmahl zum Ausdruck bringt. Für den Heiden aber blieb es beim rein äußerlichen Schmausen und Trinken zu Ehren der Gottheit und aus Furcht vor den Toten. Dieses germanische Brauchtum hat das Christentum völlig ausgelöscht; auch die Totenmahlzeit, die die Hinterbliebenen den Leidtragenden noch heute in vielen Gegenden Deutschlands rüsten, hat mit dem alten germanischen Opferfeste nichts zu tun. Sie war früher einfach die Abstattung des Dankes für das Trauergeleit und war nötig als Wegzehrung für die weiter entfernt Wohnenden. Wenn sich also im November, dem Totenmonat, die Menschen zu ausgiebigen Gastereien zusammensetzen, so liegt dabei keinerlei Erinnerung an alte Totenfeiern mehr vor. Wohl aber lassen die noch heute üblichen Schmausereien bei den Schlachte- „Festen“ recht anschaulich die Freude am gewaltigen, zuweilen tagelangen Essen und Trinken unserer Vorfahren erkennen, die in solchen Zeiten der Völlerei einen allgemeinen Waffenfrieden verkündeten, um Unheil durch die Trunkenen zu verhüten, und die im Jahre 14 nach Chr. Geb. zu Ehren der Tansana, der Erntespenderin, in solchem Uebermaße feierten, daß es Germanikus ohne Mühe gelang, die Wehrlosen zu überraschen und niederzumetzeln. Schon das Verschen: „Zu Märtin, läßt die Freude am Schweineschlachten und Sichgütlichtun erkennen. Ein rechtes Schlachtefest hat es aber auch in sich; erst der Weltkrieg und die folgenden Notzeiten haben Essen und Trinken bei den Schlachtungen auf ein gesundes Maß zurückgeführt. Doch daß noch heute ein wirkliches Fest zum Schweineschlachten gefeiert wird, geht daraus hervor, daß beinah allgemein die Kinder unserer Gegend Schulfreiheit für diesen Tag beanspruchen, Verwandte eingeladen werden und abends heischende Burschen und Mädchen kommen, das Ihre zu holen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war in unserer Heimat zum gewöhnlichen Schlachtefeste folgende fröhliche Tageseinteilung üblich: Morgens früh aß man Wurst, Stammende, Brot, trank Branntwein.
½11Uhr abends: Kaffee und Kuchen. — Branntwein, Bier, Kofent gab es während des ganzen Tages. Und wenn Mitternacht die Gäste nach Hause zogen, bekamen sie ihre Schlachteschüssel mit allerhand guten Dingen mit auf den Weg.[60] Ganz ohne Anklänge an ältestes Brauchtum sind aber selbst heutigen Tages die Schlachtefeste nicht. Burschen und Mädchen erscheinen als Bettelvolk verkleidet und meist, nach altem Glauben zum Schutz gegen die Einwirkung feindlicher Dämonen, völlig unkenntlich. Sie sagen den Vers her: „Ich habe gehört, Ihr habt geschlacht't, Diesen Versen folgen noch einige Späße, und dann ziehen die Heischenden mit gefüllten Körben ab. Zuweilen erscheinen die Burschen auch wohl, um ganz unkenntlich zu sein, als Kesselflicker und Kesselflickerin verkleidet, führen in einer Kiepe Becken, Blechröhren, Küchengeräte mit und vollführen damit ein ungeheures Gelärm. Die Heischenden selbst müßen ganz schweigsam sein, werden aber von den übrigen Anwesenden gehänselt und zum Spaßmachen gereizt, so daß sie schließlich einen Tanz ausführen. Das Ganze klingt an Fastnachtsscherze an. Für ihr Auftreten, ihre Späße, ihren Tanz erhalten sie dann eine Schüssel mit frischer Wurst, die mit den übrigen Burschen geteilt und im Wirtshaus verzehrt wird.  III. Der WeihnachtskreisIm Kreislauf des Jahres haben die Menschen gesät, sie haben das Gedeihen abgewartet, haben geerntet und in die Scheunen gesammelt. Nun lastet der Nebelmonat über den kahlen Gefilden, Winterstürme und Schneegewölk sind nun die Stoppelvögte, der Bauer hat ihnen das Feld geräumt. Er hilft den Knechten drinnen beim Drusch oder sitzt selbst an der Hobelbank und bessert sein Arbeitsgerät aus. Frauen und Mädchen aber haben eifriger denn je zu tun, das Kleinvieh zu füttern und zu mästen, die Federn zu sammeln und Betten zu stopfen, zu nähen, zu flicken und vor allem abends in den Spinnstuben die Rädchen laufen zu lasten. Je unwirtlicher und einsamer es draußen geworden, umso näher rückt man drinnen zusammen, arbeitet gemeinsam und bereitet auch wohl ein gemeinsames Fest vor. Doch wenn man sich auch, so gut es gehen will, durch Arbeit und Vergnügen die Zeit vertreibt, der trübe Tag, der Regen, die Kälte bedrückt doch das Gemüt und erweckt die Sehnsucht nach freundlicheren Monden. So ist es, wenn einmal Fröhlichkeit auskommt, doch eine gedämpfte Fröhlichkeit, und nur das hoffnungsfrohe Jungvolk in der Spinnstube erlaubt sich auch einmal Lärm und derben Spaß. Im ganzen aber ist die Zeit gegen des Jahres Neige erwartungsvoll und still. In der Dunkelheit erhofft man schon wieder das Licht. Während draußen alles kahl ist und verdorrt, hofft man auf die Blüte. Im Mittwinter hoffte der Landmann einst auf den Mittsommer, wie wir heute gleich nach Weihnachten wohl Reisepläne für den Sommer machen oder die Ausgestaltung des Gärtchens bedenken Der erste Tag, der in den Zauber des düsteren Mittwinters hineinführt, ist der 30. November, der Andreastag. In der Hoffnungslosigkeit der Jahreszeit hofft man auf das kommende Jahr und sucht dafür die Zukunft zu ergründen. Am Andreastage sind es vor allem die jungen Mädchen, die an spätere schöne Tage denken. St. Andreas wird seit alters „mitissimus sanctorum“ genannt, wird für den gütigsten der Heiligen gehalten, den sich deshalb die liebebedürftigen Mägdlein zu ihrem Schutzpatron erkoren haben. Mit Recht hat man angenommen, daß der christliche Heilige an die Stelle des alten Fruchtbarkeits- und Lichtgottes Freyr getreten ist. Aber dem Freyr ist nicht nur die Andreasnacht geweiht, er erscheint auch nicht nur neben Wotan und Frau Holle in den heiligen Tagen der Wintersonnenwende, sondern er ist überhaupt der Gott, der am Ausgang des Jahres an erster Stelle verehrt worden ist. Am Andreastage werden selbst heute noch einige durch das Christentum nur wenig verschleierte Bräuche ausgeübt. Eigentlich zum Andreastage gehört es, wenn in der Goldenen Aue noch bis Ausgang vorigen Jahrhunderts am Martinsabend der junge Mann mit seinem Schatz in den blätterkahlen Garten ging, hier ein dürres Obstreis brach, es in die warme Stube brächte, dort in Wasser stellte und nun erhoffte, daß das leblose Reis zu Weihnachten junge Triebe oder womöglich Blüten angesetzt habe. Blieb der Zweig vertrocknet, so galt das als schlimme Vorbedeutung für den künftigen Ehebund, schlug er aus, so war ein segensreicher Bund von Dauer verheißen. Doch die Männer sind meist nicht so neugierig, wer ihnen einst als Eheliebste beschert ist und wie die Ehe gerät; für die Mädchen steht diese Frage viel mehr im Mittelpunkt des Interesses. Diese sind es vor allem, die in der Andreasnacht in den Garten gehen, einen Kirsch-, Apfel-, Flieder- oder Holunderzweig brechen und bis Weihnachten behüten, damit er Blüten trägt.[61] Auch gruben die Mädchen einst, wie es z. B. aus Rottleberode noch für die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts bezeugt ist, in der Andreasnacht zwischen 11 und 12 Uhr Wurzeln aus, um die Zukunft zu erfahren. Oder sie holten sich, wie in Stolberg, ein Scheitholz in ihre Kammer, bewahrten es bis Weihnachten und legten es am ersten Feiertage frühmorgens in die Glut. Wenn alle Hantierung richtig beobachtet worden war und das Mädchen ging dann in die Weihnachtsfrühmesse, mußte ihr auf dem Kirchgang als erster der begegnen, der einst ihr als Mann beschieden war. Am Andreasabend übten die Mägdlein ähnlich wie am Thomastage, dem 21. Dezember, oder zu Silvester und anderen Tagen des Wintermonats gemeinsam auch das Bleigießen, das Schuhwerfen, das Halmholen und anderen Zauber, um die Zukunft zu ergründen. Den stärksten und sichersten Zauber aber, den die Mädchen in der Andreasnacht und zu Silvester ausüben konnten, mußten sie allein im stillen Kämmerlein vornehmen. Er bestand darin, wie in unserer Heimat aus Lipprechtervde bezeugt ist, daß das Mädchen nackt vor einen Spiegel trat und dann in ihrem Schattenbilde den künftigen Gemahl zu sehen vermochte. Auch beteten sie wohl dabei: „Dresmes! Die Zauberkraft des urgermanischen Brauchs besteht in dem Spiegel und der völligen Nacktheit. Der Spiegel, die Fläche, die das Eigenbild zurückzuwerfen vermag, galt den Germanen als Zauberding, das Verborgenes enthüllen konnte, wie ja auch im Märchen von Schneewittchen das Spieglein an der Wand verkündet, wer die Schönste im ganzen Land sei. Noch ursprünglichere religiöse Bedeutung kommt der Nacktheit zu. Nackt trat einst der Mensch bittflehend und opfernd vor die Gottheit, um ihr zu beweisen, daß er dem göttlichen Wesen nichts verhülle, sondern ihm sein wahres, natürliches Sein zur Schau stelle und vor der Gottheit demütig und nicht eitel sei. Führt das Zauberwesen des Andreastages in älteste Zeit zurück, so haben in den Bräuchen des Nikolaustages am 6. Dezember etwas jüngere heidnische Anschauungen ihren Niederschlag gefunden. Zu Nikolaus erscheint der Reiter auf dem Schimmel mit seinem wilden Gejeit oder der Knecht Ruprecht. Beide sind identisch mit dem alten Wettergott und Seelenanführer Wote, dem späteren Himmelsgotte Wotan. Weil das Brauchtum am Nikolaustage gänzlich auf Wote und nirgends auf Freyr oder Donar weist und zugleich an diesem Tage und von diesem Tage an bis Weihnachten der Knecht Ruprecht auftritt, so glauben wir, daß Ruprecht als der rauhe Knecht, der Poltergeist, zu deuten ist und nicht als Hruodperacht, d. h. der Ruhmglänzende, Strahlende, womit der Gott Freyr gemeint wäre.[62] Zu Nikolaus stürmt die wilde Jagd daher, schüttelt die Bäume, tobt im Kamin, klappert an den Schindeln, sprengt die Türen und poltert hinein. Allenthalben in unserer Heimat ziehen Kinder und junge Leute an diesem Tage in allerhand Vermummungen herum, ahmen die Poltergeister der wilden Jagd nach, schrecken die Menschen auf den Straßen, pochen an die Türen und ängsten die Kleinen. Allen voran der Anführer der Polterteufelchen, der Knecht Ruprecht. Doch sie machen nicht bloß gruseln, sondern sie erfreuen die Kinder auch mit ihren Gaben und spenden Aepfel, Nüsse und Honigkuchen. Hierbei hat sich heidnischer Brauch und christlicher Glaube innigst verbunden. Schon in ältesten Zeiten war es Sitte, sich in böser Winterzeit gegenseitig zu erfreuen und aufzuerbauen, damit Not und Kälte leichter ertragbar sei. Der christliche Bischof Nikolaus von Myra aber, dem der 6. Dezember geweiht ist, war nach der Legende ein besonders kinderlieber Mann, der nicht gar oft ein Kindlein unbeschenkt von bannen ließ, besonders wenn es sein artig und sromm war. So erscheint der christliche Nikolaus oder der heidnische Ruprecht auch heute noch am Abend des Nikolaustages in den Stuben und sragt die harrenden Kleinen, ob sie artig gewesen seien und beten können. Und wenn die Frage Bestätigung gefunden, teilt der gute Nikolaus aus seinem vollen Sacke aus. In Stolberg wurde einst der Tag besonders festlich begangen, und die Kinder wurden mit Puppen und Spielzeug aller Art beschenkt wie sonst zum Christfest oder früher zu Neujahr. Freilich, daß auch der christliche Nikolaus ein „Ruppert“ sein und poltern und drohen und gar schlagen kann, beweist die Rute, die er mit sich führt und schwingt, wenn er irgendwo eine Unart weiß. Doch so ganz ernst nimmt die Kinderschar den gutmütigen Poltergast nicht, und so singt sie denn überall in unserer Heimat nicht ganz ehrfürchtig: Nikolaus, sei unser Gast, Mit dem Nikolaustage befinden wir uns mitten in den Vorbereitungen für die heiligste Zeit des Jahres. Die Tage werden kürzer und kürzer, das Sonnenlicht scheint fast zu erlöschen, die Menschen werden immer kleiner vor dem großen Naturgeschehen und immer erbärmlicher in der Dunkelheit des Winters. Da gingen unsere Altvorderen daran, dem fast vergehenden Sonnengotte zu helfen, und stellten oder hängten überall sein Sinnbild, das Sonnenrad, auf, runde Räder, geflochten aus dem einzigen, was noch das Grün des Lebens zeigt, aus Fichten oder Eiben- zweigen. Und diese Sonnenräder, unsere Adventskränze, wurden nach und nach mit Lichtern versehen, erst mit einem oder wenigen, dann, mit zunehmender Düsternis, mit immer mehr, um dem Licht, der Wärme, der Sonne zu helfen. Nun sind die Mittwintertage da und die Tage, an denen das Jahr sich erneut. Zwölf Tage sind es, die zwischen den Zeiten stehen, weder zum alten noch zum neuen Jahre gerechnet werden, mehr Nächte als Tage, und erst am letzten dieser Tage, dem 6. Januar, dem christlichen Epiphanias- oder Dreikönigstage wird eine geringe Aufwärtsbewegung der Sonne bemerkbar, und damit beginnt die Arbeit wieder und zugleich das neue Jahr. Den alten Germanen waren die 12 Tage oder vielmehr die 12 Nächte vom 26. Dezember bis zum 6. Januar heilig. Da die geweihten 12 Nächte, die Weihnachten,[64] nach Nächten und nicht nach Tagen benannt sind, muß ihre Heiligkeit urindo- germanisch sein und aus einer Zeit stammen, als man noch nicht nach Tagen, sondern nach Nächten zählte; denn das Wort Nacht ist allen indogermanischen Sprachen gemeinsam, nicht das Wort Tag. Auch scheint schon aus dieser Bezeichnung als Fest der 12 Nächte Hervorzugehen, daß es für die Germanen nicht an erster Stelle ein Wintersonnenfest war. Nicht die Verehrung der Sonne stand in seinem Mittelpunkt, sondern ein Dämonenzauber, später ein Fruchtbarkeitszauber. Schon das Heidentum hat für die zwölf heiligen Tage verschiedenen Glauben und damit verschiedenes Brauchtum übereinander gelagert. Ost genug ist dieses Brauchtum beschrieben und gedeutet worden; es gilt aber auch die einzelnen Schichten, denen die kultischen Handlungen und Begehungen entstammen, auseinanderzuhalten. Und so wollen wir drei heidnische Stufen unterscheiden, aus welche als vierte die christliche folgt. Die älteste Brauchtumsschicht für Weihnachten reicht bis in die Steinzeit zurück, in Zeiten, in denen es uns noch nicht gelingt, einzelne Völker abzusondern, auch noch nicht die Indo-germanen zu erkennen, Zeiten, die noch keine Götter nach Menschenbilde geschaffen, sondern Luft und Erdreich und Kluft und Höhle mit furchtbaren Totendämonen bevölkert haben. Ur- religiös ist die Vorstellung, daß in den Tagen, wo Nacht die Erde drückt, die Abgeschiedenen heraufsteigen, allenthalben ihr Wesen treiben und daß nur stärkster Zauber ihre Bosheit bannt. Dieser Urzeit scheint zu entstammen, daß man reiche Gabentische auf- stellt und Speisen bereit hält, damit die wilden, neidischen Wesen, die Luft und Erde bevölkern, zufriedengestellt werden und über dem Schmausen und Trinken ihr böses Treiben vergessen.[65] Wo sie aber freundliche Bewirtung nicht abhalten kann, Schaden zu stiften, da müssen sie vertrieben werden. Ueberall in der Luft flattern die bösartigen Geister herum. Da muß man sie vertreiben durch Lärmen und Beckenschlagen, da muß man sie treffen und ihnen das Wiederkommen verleiden durch Peitschenhiebe. So üben noch heute die Burschen in den Dörfern, die Knechte auf den Gütern unserer Heimat in der Neujahrsnacht das Peitschenknallen, und einer sucht den anderen zu übertreffen. Doch gilt es nicht nur, den Unholden zu begegnen, sondern sich selbst gegenseitig zu helfen in dieser Notzeit und sich durch eigenes wackeres Essen und Trinken stark zu machen und die Zeit und ihre Dämonen zu überwinden. Auch das noch heute übliche vielfache Einsammeln und Heischen von Gaben durch die Kinder etwa am 3. Weihnachtstage oder am Neujahrsmorgen ist ein Rest jenes uralten Einsammelns primitiver Gemeinschaftskultur zu gemeinsamem Opfer und Mahle. Dieses älteste Brauchtum wird überlagert von einem jüngeren der kulturell hochstehenden seligen Bronzezeit, und vor allem diese Begehungen, die spätere Jahrhunderte des germanischen Nordens zum Njörd-Freyr-Kultus ausgebaut haben, sind auf uns gekommen und geben unserem Weihnachtsfest den Glanz und die Weihe. Natürlich hatte die Bronzezeit, deren Blüte wir um 1500 vor Christi annehmen, die Namen der späteren Wanengötter noch nicht gefunden, aber ganz ähnliche und sehr hochstehende Vorstellungen von den Gottheiten und ihrem Wirken hatten sich schon gebildet. Aus schwedischen Felszeichnungen entnehmen wir mit Gewißheit, daß im Mittelpunkt aller Verehrung, wie überhaupt, so besonders zum Mittwinterfeste, eine Licht-Fruchtbarkeits-Gottheit stand, die wir nach Bildnissen jener Zeit den Gott mit den großen Händen oder mit der Axt nennen und die kein anderer als der spätere nordgermanische Gott Freyr ist, der wiederum unserem Donar nahesteht. Kossinna deutet den Gott mit den großen Händen als die Morgenröte; sicher steht er mit der Verehrung der Sonne in engster Beziehung, wie eine Zeichnung von Kinnekulle in Vestergötland erkennen läßt[66], die den Gott mit einer großen Hand und gespreizten Fingern darstellt, ihm in die andere Hand eine Axt gibt und daneben das Sonnenrad zeigt. Daß dieser Gott zugleich der Fruchtbarkeitsgott ist, beweist das Bild „die Hochzeit“, auf dem neben den beiden Liebenden der Axtgott steht.[67] In welchen Formen die Verehrung vor sich ging, zeigt der berühmte schöne Sonnenwagen von Trundholm. Auf einem Wagen, die Lande segnend, zogen die Götter herum und wurden angebetet wie in späteren Zeiten der doppelgeschlechtige Nerthus. Kaum denkbar erscheint es uns, daß in diesen frühen Zeiten die Germanen keine Priester gehabt haben sollen. Viele der schwedischen Felszeichnungen scheinen sie darzustellen, und ein offenbar hochentwickelter Kultus fetzt sie voraus. Erst für viel spätere kriegsrauhe Zeiten wird der Bericht Caesars gelten, die Germanen hätten im Gegensatz zu den Kelten keine Druiden, keine Priester gehabt.[68] Vielleicht mag die Zahl der verehrten Götter, von denen Freyr später die erste Stelle einnahm, 12 gewesen sein, und jedem von ihnen würde dann einer der heiligen Tage geweiht gewesen sein. Ganz falsch erscheint es jedenfalls, wenn manche Forscher meinen, in der Vorstellung der Germanen sei der Umzug der Götter mit Sturmgebraus verbunden gewesen. Hier wird ursprünglich bronzezeitliche Begehung, die sich im Freyrkultus fortpflanzt, mit späterem Wotanglauben zusammengeworfen.[69] Feierlich, still, andächtig, erwartungsvoll verhielt man sich während der 12 Tage, da die Götter durch die Lande wallten. Nicht ziemte es sich zu arbeiten, zu hasten, zu lärmen. Ein Nachklang der Feierlichkeit des Begängnisses erscheint noch darin, daß es bis ins 19. Jahrhundert bei uns für ungehörig galt, an den ersten der 12 Tage zu pfeifen. In Haferungen mußte sich der, welcher während der heiligen Zeit pfeifend durch die Scheune ging, mit einer Buße lösen. Auch glaubte man, daß in der Weihenacht um 12 Uhr würden: Alle Wasser zu Wein Der Rosmarin aber war dem Freyr geweiht. Wenn Mädchen oder Frauen sich einfallen ließen zu spinnen, so beschmutzte ihnen Frau Holle, die natürlich aus einer späteren Anschauung übernommen ist, die Wocken. Nähten sie, so war Freyr, der Fruchtbarkeitsgott, erzürnt, und die Hühner legten keine Eier. Schwere Arbeit, wie z. B. Wäsche waschen, war gänzlich verpönt; in Liebenrode glaubte man, daß während der 12 Tage kein Lederzeug geschmiert werden dürfe, sonst würden Menschen und Vieh krank und hätten das ganze Jahr hindurch an sich selbst mit Salben herumzuschmieren. Wie man keine schwere Arbeit tun sollte, so durste man auch keine schweren Speisen, etwa Hülsenfrüchte essen, sonst bekam man Schwären oder gar, wie man in Bebra glaubte, die Krätze. Dagegen war alles Schweinerne erwünscht. Freyrs heiliges Tier ist nämlich der Eber mit den goldenen Borsten, und man ehrte den Gott, wenn man ihm ein Schwein opferte und selbst von der Opfergabe schmauste. Noch heute werden gern zu Weihnachten unter allen möglichen Figuren besonders gern Marzipanschweinchen hergestellt oder gar Tonschweinchen, die man mit irgendeinem Grünkram besäen kann. Und zu Neujahr sendet man sich Karten mit dem Bilde eines Schweinchens. Das sind Glücksschweine, und wer sie erhält, hat eben das ganze Jahr „Schwein“.</ref>Sonst wird der Ausdruck „Schwein haben“ auch darauf zurückgeführt, daß bei Volksfesten, etwa bei Schützenfesten, der Gewinner des letzten Preises ein Schwein bekam.</ref> Natürlich bestimmt der Fruchtbarkeitsgott in den 12 heiligen Tagen auch das Wetter der kommenden 12 Monate: „Wie sich's Wetter vom Christfest bis Dreikönigstag verhält, Sooft der Hahn am Weihnachtsmorgen kräht, soviel Taler kostet das Getreide im nächsten Jahre, und in vielen Orten unserer Heimat, so z. B. in Haferungen und Berndten, glaubt man, daß Träume in den zwölf Nächten in dem betreffenden Monat des Jahres in Erfüllung gehen. Mädchen gehen in der Christnacht in die Scheune und holen sich wahllos eine Hand voll Halme. Ist der Fruchtbarkeitsgott dem Mädel gewogen, so läßt er sie Weizenhalme in ihrem Bündel finden, und dann bekommt sie einen wohlhabenden Mann. Ueberhaupt drehen sich viele Bräuche um die Gedankenwelt, die sich mit Liebe, Ehe, Fruchtbarkeit beschäftigt. Schon erwähnt ist, daß die jungen Mädchen, wie am Andreastage so zu Silvester, allerlei Liebesorakel befragen. Abgesehen von den bekanntesten sei noch erwähnt, daß man bei uns, z. B. in Groß- Furra und in Groß-Berndten, zu Silvester gern fließendes Wasser holte, ein frisches Ei hineintat und nun aus der Figur, die das Eidotter im Wasser annahm, den Liebsten zu erkennen versuchte. Oder, eine ledige Person holte einen Arm voll Holz in die Stube, ohne die Stücke zu zählen. Stellte sich dann heraus, daß es eine gerade Zahl war; so heiratete sie im nächsten Jahr, andernfalls mußte sie nächste Silvester ihr Glück nochmals probieren. Aber auch unsere Weihnachtsgebäcke, deren Form freilich größtenteils auf das Brauchtum des späteren Heidentums hinzielt, zeigen wenigstens zum Teil eine Fruchtbarkeitssymbolik, so vor allem das Weihnachtsgebäck, das am Südrande unserer Heimat in Frankenhausen, Bendeleben, Friedrichsrode, Keula, Groß-Brüchter u. a. Orten Schiedchen oder Schüttchen genannt wird, und bei dem der Teig mit Einkerbungen versehen oder ein Teil über den anderen geschlagen wird, so daß eine Art Tasche entsteht.[70] Auch die Hörnchen gehören hierher, ein Gebäck, das an Stelle des Opfers eines Widders getreten ist. Der Bock aber war dem Fruchtbarkeitsgotte Donar heilig, und Donar mit dem Hammer gehört ganz in die Nähe Freyrs, des Gottes mit der Axt; beide sind Lichtgottheiten, nach Kossinna versinnbildlicht Freyr die Morgenröte, Donar den Blitz und die Sonne. Schließlich sei hier noch des Fruchtbarkeitszaubers des Kindelns, dialektisch auch Kingelns, am 3. Weihnachtstage gedacht, das noch heute fast überall in unserer Heimat geübt wird, wenn auch in manchen Orten der ursprüngliche Sinn gänzlich verdunkelt ist und niemand mehr ahnt, daß es der Schlag mit der Lebensrute ist, den die Kinder austeilen, wenn sie am dritten Festtage durch die Straßen eilen, die Vorübergehenden mit Schlägen bedenken und dabei rufen: „Guten morgen, guten morgen“, oder wenn sie, wie in Hamma von Haus zu Haus ziehn und den Hausherrn schlagen, bis sie mit Speise und Trank bewirtet werden. Bei dem Brauchtum der meisten Ortschaften tritt aber der alte Zauber des Rutenschlagens noch leidlich klar zutage. In Haferungen, in Nohra, in Rodishain, in Rüxleben, in Üthleben, in Urbach prügeln sich nicht nur die Kinder aus den Betten, sondern da erscheinen die jungen Burschen in den Kammern der Mädchen, prügeln sie und lassen nicht eher ab, bis sie sich gelöst haben. Unser junger Gewährsmann aus Hauröden war bei der Schilderung des Brauches so minutiös, daß er angab: „Am 3. Weihnachtstage, morgens 8 Uhr holen die Burschen die Mädchen mit einem Stock aus dem Bett.“ Hier ist also die Bedeutung des Brauches klar erkenntlich; es ist der Schlag mit der Lebensrute, der ausgeteilt wird, auf daß die Menschen fruchtbar seien und sich mehren.[71] Diese Sitte des Kindelns paßt so gut in das ganze heidnische Weihnachtsbrauchtum hinein, daß heute wohl alle Forscher es schärfstens ablehnen, das Kindeln in Zusammenhang mit dem Bethlemitischen Kindermord zu bringen. Der 28. Dezember ist der Tag der „unschuldigen Kindlein“. Auch wir glauben, daß das Rutenschlagen auf einen altheidnischen Fruchtbarkeitszauber zu beziehen ist, er braucht aber nicht notwendig zu den Weihnachtsbräuchen zu gehören. Im Mansfeldischen wird er am Mittwoch nach Ostern geübt, in der Halberstadt-Braunschweiger Gegend am Aschermittwoch, sonst auch wohl zu Lichtmeß; und hier in die Frühlings- oder Vorfrühlingszeit, wo man, wie Pflanze und Tier, so auch dem Menschen helfen möchte aufzublühen und Frucht zu tragen, gehört er mindestens so gut hin wie in die Weihnachtszeit zum alten Fruchtbarkeitsgotte Freyr. Nicht von der Hand zu weisen ist es deshalb, daß in unserer Heimat, wo am 27. Dezember, und östlich davon, wo direkt am 28. Dezember, dem Tage der „unschuldigen Kindlein“, gekindelt wird, der Gedanke des alten heidnischen Zaubers verloren gegangen und dafür die christliche Vorstellung vom Erschlagen der Kinder eingetreten ist. Ueber die beiden ältesten Schichten heidnischen Brauchtums legt sich schließlich noch eine dritte, die Wotan und seine Gemahlin Frija oder Freya und die Frau Holle in den Kreis der heiligen 12 Tage bringt. Erst mit diesem späteren Heidentum ist der Glaube aufgekommen, in den 12 Nächten gehe die wilde Jagd um und Wotan mit ihr an ihrer Spitze. Aus dieser Vorstellung wird der Glaube genährt, die Weihezeit sei keine stille, andächtige Zeit, sondern eine stürmische, unruhige. Dann ist es draußen nicht geheuer, wenn der wilde Wettergott, der Mantelträger, der Hackelberg oder Hackelberndt, wie er in Sülzhayn heißt, durch die Lüfte mit langnachschleppendem Gewölk braust. Daher stammt der Glaube, in den Weihnachtstagen müsse es stürmisch sein, wenn die Obstbäume Frucht tragen sollen. Sollte wirklich die Jagd ausbleiben und die Bäume nicht schütteln, so muß der Bauer selbst nachhelfen, in der Weihnacht in den Garten gehen und das Schütteln selbst besorgen, damit er noch zu leidlichem Obste kommt. Im Harz ist ferner allgemein der Glaube verbreitet, daß man in den Weihnachtstagen, besonders am 28. Dezember lieber nicht in den Wald geht, da man dort der wilden Jagd begegnet und ein Unglück geschieht. In diese gröbere Auffassung vom Wesen der 12 heiligen Tage, an denen der Wintersturm durch die Wälder wütet, ragen aber aus älterer, milderer Zeit vermittelnde Züge hinein. Zum Ausdruck kommen sie am besten im Worte Iulklapp. Nicht völlig gesichert ist die Bedeutung von „Iul“, das altnordisch hiol, jol, jul, angelsächsisch geol heißt und der Name für die größte Iahres- festlichkeit zur Wintersonnenwende war. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, daß der Name als Fest des Sonnenrades zu deuten ist, daß er also auf die Verehrung eines bronzezeitlichen Gottes und des späteren Freyr zielt.[72] Der zweite Bestandteil des Wortes Julklapp weist aber auf den Poltergeist hin, der schon seit Wochen, seit dem Nikolaustage überall rüttelt und, wenn er die Türen aufreißt, mit Donnergeklapper seine Gaben aus dem vollen Sacke auf die Erde rollen läßt. Auch bei der Begleiterin Wotans, bei seiner Gemahlin Frija, erscheinen Züge eines älteren Brauchtums. Auf sie ist übertragen, was eigentlich mit Freyr verbunden ist. Sie fährt segnend durch die Lande, schaut bei den Hausfrauen nach dem Rechten, lohnt die Tüchtigen, straft die Säumigen. Doch paßte diese Schutzherrin aller sittsamen weiblichen Hantierung eigentlich nicht recht an die Seite des rauhen Wotan, und so trat, ganz besonders in unserer Heimat, an Stelle der Göttin Frija die alte Wetterhexe Frau Holle. Ihr ist der letzte der 12 Tage, der 6. Januar, der englische twelfth day, als Frau-Hollentag geweiht. Grundfalsch ist es, Frija und Holle gleichzustellen. Freilich hat man auf die Frau Holle einige Eigenschaften der Frija übertragen und läßt sie die Beschützerin aller hausfraulichen Pflichten sein; aber ihr ursprünglicher Charakter als mißgünstiger Wetterdämon an der Seite des Wettergottes Wotan schaut überall hervor. Daß aber der kriegerische, auf achtfüßigem Rosse daherstürmende, von seinen Raben und, wie man im Harze sagt, von der Tutursel, der Eule, begleitete Wotan germanischem Charakter genehm war und seine Gestalt bis in die jüngste Vergangenheit festgehalten worden ist, erkennen wir in den vielen Figuren des Weihnachtsgebäcks, das aus Honigkuchen, Pfefferkuchen oder irgendeinem Teig, früher auch mit Pflaumen oder Rosinen darauf, allerlei verwegene Mannsund Reiterpersonen vorstellt. So glauben wir also an diesem Winterfest in drei Schichten das noch heute lebendige Brauchtum von mehr als 3 Jahrtausenden unserer Vorfahren erkennen zu können. Für uns heute aber ist es trotz des schönen Vermächtnisses unserer Altforderen nicht nur ein Fest der Geburt des neuen Jahres, des Segens und der Fruchtbarkeit, sondern das Fest, da uns das Heil schlechthin, da uns der Heiland geboren ist, kurz, es ist das Christfest. Wie bei keinem anderen Feste hat sich gerade hier christlicher Glaube und christliche Heilslehre germanisch-heidnischen Anschauungen anschmiegen und einfügen können, ein Zeichen dafür, daß die christliche Ideenwelt zwar nicht germanischem Tatendrang und kühnem Willensentschluß gerecht werden kann, für unser tiefstes Gemütsleben aber den durchaus geeigneten Ausdruck findet. Da erscheint im germanischen und christlichen Brauchtum zugleich die Forderung des Gebens und Helfens. So schufen die Germanen einst ihre Weihnacht und gestalteten sie zu einem Feste der Liebe zu jedermann und der Freude für jedermann, indem sie in der düstersten Zeit des Jahres einander durch Geschenke fröhlich zu stimmen und zufriedenzustellen suchten, indem sie die Kinder bedachten, den Armen und Schwachen und Notleidenden halfen. Genau dasselbe tut das Christentum. In den Tagen, da das Heil geboren ward, und als armseliges hilfsbedürftiges Kindlein in der Krippe lag, darf keiner leer ausgehen und am wenigsten die, die am meisten bedürftig, wie es in C. F. Meyers „Gleitendem Purpur“ künstlerische Verklärung gefunden hat. Ebenso ist germanischer wie christlicher Glaube, daß trotz Nacht und Trübsal die Hoffnung auf Erneuerung und Wiedergeburt des Lebens nicht erlischt. Das germanische Sinnbild dafür sind die Pflanzen, die im Winter grünes Kleid tragen, wie Fichte, Eibe, Stechapfel, oder es ist die ausdauernde Eberesche im hohen Norden und auf Island und in England die Mistel, die im Winter blüht und fruchtet. Diese Pflanzen lassen erwarten, daß bald alles Leben wieder erwacht, ebenso wie die Geburt des Herrn, der neues Heil bringt, so daß das deutsche Weihnachtslied beides gleichsetzen kann, wenn es singt: „Es ist ein Reis (Ros') entsprungen“. Und dieser Heiland durchstrahlt das Dunkel des Winters und die Trübsal der Welt und durchglüht mit seinem Glänze die Menschen, damit sie nicht in Trotz und Verhärtung verharren, sondern „Kinder des Lichts“ sind. Aus dieser Ideenwelt heraus ist Weihnachten so heute wie vor 3000 Jahren das Fest des Lichtes in der Finsternis. Schon im frühen christlichen Mittelalter erstrahlten zu Weihnachten die Kirchen im Glänze von tausend Kerzen, und in den Häusern waren die Wachsstöcke aufgestellt, wurden später die feststehenden oder drehbaren Weihnachtspyramiden aufgebaut und wurde schließlich in neuerer Zeit der geschmückte Weihnachtsbaum entzündet. So decken sich germanischer und christlicher Brauch nahezu restlos; einträchtig bringt der Weihnachtsmann, der „Alte“, wie er hie und da bei uns noch heute genannt wird und der kein anderer als Wotan ist, — einträchtig bringt der Weihnachtsmann neben dem Christkind seine Gaben, und wenn am Heiligen Abend zu Lipprechterode Vermummte in weißen Laken herumziehen, so ahnen sie nicht mehr, daß sie die weißes Schneegewölk heranführende Frau Holle darstellen, sondern sie meinen, den heiligen Christ, das fleckenlose Lamm Gottes, nachzuahmen. Auch der überall in unserer Heimat, nicht zuletzt in Nordhausen übliche Gang zur Christmette entspricht ganz und gar sowohl germanischem wie christlichem Gefühlsleben. Die Christmette trägt durchaus die Vorstellung vom segensreichen Umzug der Götter in den 12 heiligen Tagen an sich und ist eben deshalb, weil sie in uns urälteste Gefühlstöne weckt, so wurzelecht, daß seit grauster Vergangenheit alljährlich immer wieder am Heiligen Abend oder am ersten Festtag morgens die Kinder durch die heimliche, schweigende Winternacht mit ihren Wachsstöcken oder Lampions oder ihren erleuchteten Krippen ziehen. Dieses Begängnis ist so eindrucksvoll, daß man wieder und wieder daran denkt und selbst unscheinbare Begebenheiten damit in Zusammenhang bringt. Es gibt an rußigen Töpfen, wenn sie vom Feuer genommen werden, oder auch an Ofentüren eine eigentümliche Erscheinung: der Ansatz von Ruß verbrennt hie und da, und so entstehen auf schwarzem Grunde leuchtende Punkte. „Die Leute mit ihren Lichtern ziehen durch die dunkle Nacht zur Christmette“, sagt man bei dieser Erscheinung in Kelbra. Die heilige Handlung der Messe selbst in der Kirche ist natürlich nur aus dem Erlebniskreis des Christentums entstanden, erfaßt aber doch ganz das deutsche Gemüt, wenn der Pfarrer die frohe Botschaft verliest und die am Altar stehenden oder auf der Empore verteilten Knaben ihren deutschen und lateinischen Wechselgesang anstimmen. — Der ersten geweihten Nacht folgen dann die anderen bis zu dem Dreikönigstage hin. Der Abend des ersten Festtages hieß Spinnabend. Früher war es in vielen Orten, so z. B. in Groß-Berndten üblich, daß die Mädchen an diesem Abend für ihre Burschen die Bäume schmückten und die Jugend ein frohes Gemeinschaftsfest beging. Dann folgen bis Neujahr hin die verschiedenen Heischegänge der Kinder. Sie beginnen mit dem dritten Weihnachtstage, wo noch heute vielerorts, wie z. B. in Urbach, frühmorgens die Kleinen an die Betten der Erwachsenen kommen und sich Gaben erbetteln. Vor allem aber erfolgt das Heischen der Kinder und einst auch der Erwachsenen am Neujahrstage.[73] Neujahr war früher der eigentliche Geschenktag für groß und klein. Daher stammt bis auf unsere Tage das sogenannte Neujahrssingen der Schulkinder. In der Goldenen Aue war es früher üblich, daß die Kinder in der Adventszeit bis Neujahr singend durch die Dorfstraßen zogen und Gaben einsammelten. In Bennungen streiften sie einige Tage vor Weihnachten herum und sprachen: Busch, Busch, Flederwisch, In Nordhausen zogen die Gymnasiasten mit ihren Vorsängern nach Neujahr 14 Tage bis 4 Wochen herum, erhielten Gaben und wurden bewirtet. Der Brauch hat sich aus mittelalterlicher Zeit bis zum Jahre 1849 gehalten, dann wurde er nach einer Schulrevision abgeschafft, weil die Behörde glaubte, daß wochenlang ausgedehntes winterliches Herumsingen die Gesundheit und die schulischen Leistungen beeinträchtige. Je mehr dieses behördlich organisierte Singen und Heischen überall verschwand, umso mehr haben die Kinder auf den Dörfern, welche auf die ihnen zustehenden Geschenke und Schmausereien nicht verzichten wollten, ihre Heischegänge auf eigene Faust organisiert. So tönt denn auch heute noch in den meisten unserer heimatlichen Dörfer am Neujahrsmorgen von herumziehenden Kindern: Es geht 'ne Kette um das Haus. In Benneckenstein heißt das Verschen etwas vollständiger: Eine goldene Schnur geht um das Haus, Die Kleinen singen: Kleine Hans Kennige, (König) Das bekannteste und üblichste Heischelied singt folgendermaßen: Drei Rosen, drei Rosen, die wachsen auf einem Stengel, In Niedersachswerfen wird noch angehängt: Der Herr, der kriegt nen goldenen Wagen, Ebenso verbreitet ist: Klingelingeschar, Klingelingeschar. Mit dem 6. Januar, dem Frau-Holletag, dem Tag der heiligen Dreikönige, geht die heilige Zeit zu Ende. An diesem Tage fand im Mittelalter ein kirchliches Festspiel statt, in dessen Mittelpunkt die drei Weisen Kaspar, Melchior und Balthasar standen, welche von der Offenbarung, die ihnen geworden war, berichteten und dann das Erlebnis von Bethlehem hatten. Als allerdings dürftiger Rest dieser einstigen Spiele ist das Umhertragen des Herodeskasten durch die Kinder am Dreikönigstage auf- zufassen, das sich in unseren Gegenden und besonders auf dem Eichsfelde bis in die 80er Jahre vorigen Jahrhunderts gehalten hat. Zuletzt bezeugt ist es noch für Bebra, Benneckenstein, Elende, Nohra, Oberdorf und Rehungen. Der Herodeskasten bestand aus einer Laterne oder einem Stern von transparentem Papier, auf dem ein Haus mit Fenstern gemalt war. Die Fenster tonnten durch Federn geöffnet und wieder geschlossen werden, so daß man eine Figur, den Herodes, Herausschauen lassen konnte. Beim Umtragen dieses Kastens sagten die Kinder meist nur her: Herodes guckt zum Fenster raus, In Liebenrode war noch in den letzten Jahrzehnten vorigen Jahrhunderts folgender Spruch aus dem einstigen Dreikönigsspiel übriggeblieben: Kommen die Weisen aus dem Morgenland, Danach erhielten die kleinen Weisen aus dem Morgenlande ihre Gaben und verabschiedeten sich mit den Worten: <poem> „Sie haben uns eine Verehrung gegeben, Der liebe Gott lasse Sie in Freuden leben. Das wünsche wir Ihnen zum neuen Jahr.“[75] Nicht von ungefähr ist es, daß vom ganzen mittelalterlichen Dreikönigsspiel nur der Herodeskasten übriggeblieben ist. Der Gang mit dem erleuchteten Stern entspricht nämlich ebenso wie der Zug zur Lhristmette dem altgermanischen Brauche des Licht- umtragens. Echt volksgemäß ist es, daß am festesten der böse Herodes, der den Bethlemitischen Kindermord beging, in der Erinnerung haften geblieben ist. Mit dem Holle- oder Dreikönigs-Tage schloß die heilige Zeit ab und das neue Jahr, das neue Werkjahr mit seinen Plagen und Sorgen, seinen Hoffnungen und Freuden begann. Am feierlichsten wurde das neue Geschäftsjahr zu Nordhausen in der Nacht vom 5. zum 6. Januar eröffnet, solange es Freie Reichsstadt war, also bis zum Jahre 1802. In dieser Nacht wurde die feierliche Wahl des neuen Ratsregimentes auf dem Rathause im Beisein der gesamten Bürgerschaft vorgenommen, eine Vollversammlung aller wehrfähigen Einwohner Nordhausens, die sich als letzter Rest jener germanischen monatlichen Things erhalten hat, bei denen alle Freien nicht nur mitraten und -taten konnten, sondern mußten, und jener jährlichen mittelalterlichen drei Vogtthings, wie sie in den Nordhäuser Einungen bezeugt sind. Vor der Wahl, morgens 4 Uhr hielt der erste Prediger von St. Nicolai eine Ansprache, danach redete einer der Bürgermeister oder der Syndikus der Stadt über die Grundsätze, nach denen die Stadt im kommenden Jahre verwaltet werden sollte. Dann wurde der eigentliche Wahlakt auf dem Rathause vorgenommen; die Namen der Gewählten verkündete der Ratsoberdiener der gesamten vor dem Rathause harrenden Bürgerschaft. Nach vollzogener Wahl gingen die Ratsherren aller drei Räte in die Spendekirche, in späteren Jahrhunderten in die Marktkirche zum Gottesdienst und Dankgebet. Das neue Jahr begann. — Das Jahr hat seinen Kreislauf vollendet. Bei der Beschreibung seines Brauchtums waren für unsere Heimat im großen und ganzen die Begehungen auszuschalten, die sich an Schiffahrt und Handel knüpfen, weil unsere bodenständige Bevölkerung rein ländlich ist. Allerdings ist das agrarische Brauchtum auch das Wesentliche; denn die Germanen sind seit Urzeiten in erster Linie ein Volk des Ackerbaues und der Viehzucht. Daß sich ferner selbst in unserer späten Zeit noch allerlei Bräuche erhalten haben, die aus einer allgemeinen menschlichen Veranlagung entspringen und die sich um Hoffen und Sorgen und Schau in die Zukunft gruppieren, haben wir gesehen. Schließlich aber lehrt die Behandlung der Aeußerungen unserer Volkheit besser als jede andere Wissenschaft und Kunst, daß nach menschlichen Maßen unvergängliches Leben nur das in sich trägt und nur das von unabsehbarer Dauer ist, was aus der gottgewollten Eigenart der Menschen und der Eigenart ihrer Umgebung naturhaft geboren ist, sich, wir können sagen, gesetzmäßig entwickelt hat und nun weiter lebt in den verschiedenen Anpassungen und Abwandlungen an neue Zeiten und neue Umwelten, aber weiterleben kann nur soweit, wie es der eigenen Art genehm ist, und vergehen muß, wenn gröblicher Eingriff unter Verkennung der natürlichen Lebensbedingungen eines Volkes und seines Charakters, unter Verkennung des Blutes und des Bodens die Wahrheit, die sich im geschichtlichen Ablauf offenbaren will, umbiegt oder verfälscht. Es gilt nicht, Geschichte durch Geschichte zu überwinden, wie Troeltsch meint, sondern es gilt, dem wahrhaftigen Wandel Gottes durch die Geschichte zu lauschen und in ihm zu sein. Dann erfüllt sich alles naturgemäß und damit glücklich und gut. So verstehen wir auch des großen Spaniers Cervantes Wort: Geschichte ist Wahrheit, und wo Wahrheit ist, da ist Gott.[76] 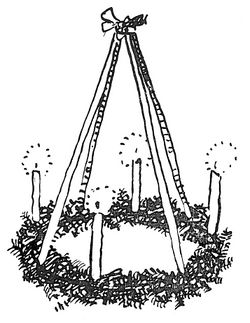 Quellen und Literatur
|
- ↑ Auf Grund der Torfmoorforschungen des schwedischen Geologen Sernander hat zuerst Kossinna nachdrücklich auf die Folgen des Klimawechsels in kultureller Beziehung aufmerksam gemacht. Vergl. Kossinna, Mannus IV und Kossinna, die deutsche Vorgeschichte . . ., Leipzig«, 143 ff. — Der Nußbaum kam in der Bronzezeit in ganz Skandinavien fort, Weizen und Hirse konnten bis Finnland angebaut werden. Entsprechend wärmer waren natürlich Polen, Deutschland, Frankreich. Nur so ist es zu erklären, daß die Germanen später, als sie nach Süden drängten, ähnliche klimatische Bedingungen wie einst im Nordland vorfanden, ihre alte Beschäftigungsweise säst unverändert beibehalten konnten und damit uraltes Brauchtum. Straffer hat recht, wenn er schreibt: „In dieser ruhig-schöpferischen und ausgeglichenen Jugendzeit — der Bronzezeit — haben die Germanen ihren inneren Reichtum und ihre riesenhafte Kraft gesammelt, mit der sie dann in der Eisenzeit Alteuropa überwältigten und das neue gestalteten.“ Und weiter: „Auch wenn wir durch die frühen Geschichtsschreiber nicht das geringste über den bei der Wende zur Eisenzeit einsetzenden Völkersturm wüßten, würde uns der weithinreichende damalige Kulturniedergang ausfallen.“ — K. Th. Straffer, Die Nordgermanen, Hamburg, 12.
- ↑ Sonst heißt es: Pauli Bekehr, Gans, gib dein Ei her.
- ↑ Vergl. Aus der Heimat, 1891, 7.
- ↑ Friedrich Schmidt, Der Kreis Sangerhausen, 2. Heft, Sangerhausen 1930, 61.
- ↑ Fr. Schmidt, a. a. o., 98. — Vergl. „Kopfnuß“.
- ↑ Vergl. P. Herrmann, Altdeutsche Kultgebräuche; Jena, 1928 40. Indiculus superstitionum et paganiarum Nr. 3 verbietet das Schmutztest. — Die Römer feierten Anfang Februar ein großes Sühne- und Reinigungsfest.
- ↑ Wettersprüche: Wie es Petrus und Matthias macht, So bleibt es 40 Tag' und Nacht. — Wenns friert Petri Stuhlfeier, Friert es noch vierzigmal Heuer.
- ↑ Der Februar heißt germanisch Hornung. Hornung ist zwar nicht mit horo = Schmutz zusammenzubringen, sondern es bedeutet Sohn des Hornes, d. h. der auf den Hornmonat, den Januar, folgende Monat. Viele Bräuche kennzeichnen ihn aber als Schmutzmonat.
- ↑ Zeidelbast, ahd. Ziolinta. Vergl. im übrigen Herrmann, a. a. o., 36.
- ↑ Zu Grunde liegt das Verbum faseln = Unsinn machen; mhd. vasenacht. — Von der Kirche ist das Fest dann in Fastnacht umgedeutet, d. h. die letzte Nacht vor Beginn der Fastenzeit. Uebrigens stammt das Wort fasten nicht aus der Kirchensprache, sondern ist gemeingermanisch; unsere heidnischen Vorfahren müßen also mit dem Wort schon einen religiösen Begriff verbunden haben.
- ↑ Vergl. unten zu Totenfesten das Erntedankfest, Martinsfest und Schlachtefest. — Zu Sangerhausen vergl. Schmidt, a. a. O., 77, Brezel aus lat.bracellum, frz. bracelet = Armring. Armspange, die man den Toten mit ins Grab legte; dann die Nachbildung der Armringes aus Teig.
- ↑ Eine andere uns nicht einleuchtende Deutung gibt Naumann: Die Leichen, vor denen der Primitive Furcht hat, laufen leicht bläulich oder schwärzlich an. Diese Toten gehen in Dämonen ein, die durch die Bemalung mit Ruß nachgeahmt werden. In Verbindung damit stellt N. das Wort Hüne, das Siebs als der Tote, Hoops als der Dunkle, Schwarze deutet. Selbst auf die schwarzen Husaren verweist Naumann. — Hans Naumann, Primitive Gemeinschaftskultur, Diederichs, 1921.
- ↑ Das fröhliche Spotten und das sich fröhlich Verspottenlassen scheint ein Charakterzug aller Starken und Selbstsicheren zu sein. Vergl. I. Burckhardt über die Spartaner. I. Burckhardt, Kulturgeschichte Griechenlands, die Polis in ihrer historischen Entwicklung, 2, Sparta.
- ↑ Mannhardt, Antike Wald- und Feldkulte, II, 184 ff. glaubt im Erbsenbär einen Korndämon nachweisen zu können.
- ↑ In Hüpstedt und Zaunröden war der „wilde Mann“ der Frühling, ein Bursche, mit Laub und grünem Reisig umkleidet, den die anderen Burschen suchen mußten und den sie dann unter lauten Freuderufen durchs Dorf führten.
- ↑ Die letzten drei Verse stammen aus Sülzhayn. — Am Aschermittwoch verbot der Aberglaube das Spinnen. Um Stolberg und Dietersdorf herum glaubten die Holzfäller, sie dürften an diesem Tage nicht in den Wald gehen, weil dort der Teufel sein Spiel treibe und ihnen ein Unglück zusüge.
- ↑ Indogermanisch ist der Brauch, an Wendetagen möglichst fröhlich, gar närrisch zu sein und alle Lebensverhältnisse umzukehren. Vergl. die römischen Saturnalien zu Neujahr, bei denen die Sklaven Herren waren. — In unserer Heimat fanden einst in mehreren Dörfern, meist um Pfingsten herum, Feste statt, bei denen die Bauern und Frauen die jungen Burschen und Mädchen bedienten.
- ↑ Vergl. Silberborth, Gesch. des Nordhäuser Gymnasiums, 70 f.
- ↑ Bei den Angelsachsen Thunresdaeg; bei den Nordgerm. Thorsdagr. Vergl. auch den Himmelfahrtstag unten S. 208. — Der spätere Ase Donar gehört ganz in die Nähe des Wanen Freyr. Seine besondere Ausgestaltung hat er verhältnismäßig früh erfahren. Er ist neben Tiu eine der ältesten Göttergestalten.
- ↑ Weigel bringt selbst diesen harmlosen Brauch, der z. B. bis in jüngere Zeit in Sundhausen im Schwange war, mit einer Geschlechtssymbolik zusammen. Weigel, Lebendige Vorzeit rechts und links der Landstraße, Metzner, 1934, 53. — Natürlich zeigt der Strauß nichts weiter als den Stolz des Knaben, der Kranz die Anmut des Mädchens.
- ↑ An germ. Brauchtum finden wir für den Karfreitag so gut wie nichts. In unserer Heimat bannt man wohl, wie schon oben erwähnt, die Hühner am Karsreitag oder treibt Ungeziefer aus. Man glaubt auch, daß junge Reiser, an diesem Tage um ein krankes Glied gewunden, dieses heilen können, wie mehrere Berichte aus Ilfeld bezeugen. Im übrigen ist der auch sonst in Deutschland verbreitete Aberglaube auch bei uns vorhanden: Der Tag, an dem der Herr gelitten, ist ein Unglückstag. Am Freitag darf man keine Reise antreten, nichts Wichtiges unternehmen, keine Hochzeit machen, die Wöchnerinnen dürfen nicht aufstehen, die Eier, die an diesem Tage gelegt sind, bringen Unglück. Damit zusammen hängt auch der Glaube, daß der Dieb, der an diesem Unglückstage nicht gefaßt wird, im ganzen Jahre bei seinem Gewerbe Glück hat (Ilfeld, Holzdiebe). Am Karfr. muß man fasten, um nicht krank zu werden (Haferungen), darf kein Fleisch essen (Bebra), es darf nichts gepflanzt werden (Bennungen). Kurzum, an dem Kreuzigungstage kann nichts recht gedeihen. — Schließlich gilt der Karfr. noch überall in unserer Heimat so recht als ein Tag für Sympathiekuren. Zahnschmerzen, Gicht, Flechten, Bruchleiden, Gesichtsrose werden an diesem Tage gebüßt. Nägel von Fingern und Zehen geschnitten und an bestimmten Orten vergraben, helfen gegen allerlei Schmerzen.
- ↑ Vergl. C. Engel, Bilder aus der Vorzeit an der mittleren Elbe, I, Burg b. Mgdb., 1930, 307. Engel ist in seinem ausgezeichneten Werke ein sehr vorsichtig und unvoreingenommen abwägender Gelehrter. Er sagt: „Auch sonst sprechen mancherlei Anzeichen dafür, daß die Religion der bronzezeitlichen Germanen ganz von den Vorstellungen beherrscht war, die uns aus den ersten geschichtlichen Quellen (Caesar, Tacitus) fast zwei Jahrtausende später überliefert worden sind und die — ein weiteres Jahrtausend später — in der Edda und den ältesten deutschen Heldenliedern am Beginn der geschichtl. Zeit anklingen.“ — Eine germanische Frühlingsgottheit mit Baldr, Baldur zu identifizieren, unterbleibt besser. Der Lichtgott Baldr ist spätgermanisch und ursprünglich sicher eine vorderasiatische Göttergestalt. Vergl. Neckel, die Ueberlieferungen vom Gotte Balder. Dortmund, 1920.
- ↑ Bei Osten liegt idg. austa zu Grunde, anord. austr., lat. aurora. — Ostern ist ahd. ostarun, agf. eastron. Die Frühjahrsgottheit austro ist nicht bezeugt, im ags. Dialekt kommt aber Eastre vor.
- ↑ Vergl. Aus der Heimat, 1891, 27. Aus 1000 Zuschriften war zu ersehen, daß die Osterfeuer im Schwange sind, wo sächsische Sitte herrscht, sonst die Johannisfeuer.
- ↑ Waldmann, Progr. des Heiligenstädter Gymnasiums, 1864. — In Rom durfte das erloschene Feuer der Vesta nur durch Reiben zweier Holzstäbe neu entfacht werden.
- ↑ Von Lätare bis Ostern waren die Altäre schwarz verhängt.
- ↑ Vergl. Aus der Heimat, 1890, eine Mitteilung von Waldmann, Heiligenstadt und Aus der Heimat, 1891, 11. Glaser, Der Sommergewinn oder das Todaustragen am Sonntag Lätare. — Für einen Opferbrauch, Menschenopfer sieht Herrmann das Todaustragen an.
- ↑ Opfern lat. Lehnwort von offerre; vergl. auch Oblate. Das germanische diotan ist ausgestorben. — In der Edda heißt es: Bester nichts erfleht als zuviel geopfert: Auf Vergeltung die Gabe schaut. Bester nichts gegeben als zu Großes gespendet; eitel manch Opfer bleibt, (deutsch von Genzmer.)
- ↑ Vergl. Kolbes Heimatland, II. 1905/06, 121.
- ↑ Das Germanische unterscheidet Zieser und Ungeziefer. Ziefer werden die Tiere genannt, die rein sind und den Göttern dargebracht werden dürfen, ahd. zebar, ags. tifer, portugiesisch Zebra, franz. Lehnwort toivre = Vieh. — Die unreinen Tiere sind das Ungeziefer.
- ↑ Dieser Maiprinz als Sinnbild des Frühlingsgottes war auch bei uns bis vor wenigen Jahrzehnten dicht umhüllt mit Gras, Laub, Birkengezweig und anderen Gaben des Frühlings. Dieser Brauch ist nicht zu verwechseln mit Opferbräuchen, die einst im Frühling stattfanden, um den ersehnten Regen her- beizuzaubern. Bei diesen Opfern mußte in grauster Vorzeit ein Menschenkind, ein junges Mädchen, dem erzürnten Gotte fallen. Später nahm man die Menschenopferung nur noch symbolisch vor, entkleidete das Opfer, umhüllte es mit grünem Laub und sprach den Regenzauber. Allein hierauf bezieht es sich und nichts mit dem Maiprinzen zu tun hat es, wenn Herrmann sagt: „Die Umhüllung des ursprünglich nackten Menschen mit Laub und Kräutern ist die Bekränzung des Opfers.“ Herrmann, Altdeutsche Kultgebräuche, Diederichs, 1928, 12. — Beispiele für das Regenopfer siehe: Aus der Heimat, 1891, Nr. 20.
- ↑ Vergl. Aus der Heimat, 1891 Nr. 16,17. Maibräuche und König Mai.
- ↑ Wodan, Wotan, Wode, Wote ist ursprünglich ein Wetter- und Sturmdämon. Vergl. Wut, wütend. Er wird unter westgermanischem Einfluß in kriegerischer Zeit zum Himmelsgott. Wotes Sturmmädchen werden zu den Walküren, die seine Befehle auf dem Schlachtfelde ausführen. Sie sind identisch mit den ursprünglicheren Hagazussa, den Hexe. - hac, hages = Wald, Gehege. hagazussa, Hexe = Waldgeist. Der Wald war den Germanen kein Ort für romantische Spaziergänge, sondern ein unheimliches, von bösen Geistern bevölkertes Revier. Der Glaube an Hexen scheint, wie der germanische Name schon zeigt, gemeingermanisch zu sein. Der Ediktus Rothari gibt für die Langobarden, die Capitulatio de partibus Saxoniae, VI für die Sachsen den Nachweis des Glaubens an Hexen. Vergl. Dörries, Germ. Religion und Sachsenbekehrung, S. 3. S. 14. Regino von Prüm erzählt, daß Weiber selbst glaubten, es ritten einige ihres Geschlechts nächtlicherweile zum Dienste der heidnischen Göttin Diana. Wenn aber auch die Vorstellung von Hexen offenbar urgermanisch ist, so ist doch unzweifelhaft, daß eigentlicher Hexenwahn und Hexen- verfolgung sich erst, und zwar nicht bloß unter Duldung, sondern unter Förderung der Kirche, im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit findet. Vergl. dazu auch Rvsenberg, An die Dunkelmänner unserer Zeit, 56 sf. — Zu Wotan vergl. unten Seite 223.
- ↑ Vergl. Silberborth, Geschichte des Nordh. Gymnasiums, 70 ff.
- ↑ Indiculus superstitionum et pagnuarum Nr. 28 handelt „von den Götterbildern, die sie durch die Fluren tragen.“
- ↑ Diese Bittprozessionen dürfen nicht verwechselt werden mit ganz anders gearteten Umgängen der Bauern zwecks Festlegung der Feldmark, der sogenannten Versteinung. Diese fand im Frühjahr oder, noch häufiger, im Herbste statt. — Vergl. Aus der Heimat, 1890, 2. Vergl. den Flurumzug der Römer, die Ambarvalia.
- ↑ Christoph Bohne, Nordhäusische Chronica, Franks, u. Leipzig, 1701, ed. Heineck, 45 ff. — Vergl. noch Jan de Vries, die Welt der Germanen, Leipzig, 1934. Im Jahre 939 befiehlt eine Aebtissin in Westfalen, die Nonnen sollten in jedem Jahr am 2. Pfingsttage den Schutzpatron ihrer Kirche in Prozession heraustragen. Sie sollten sich selbst als Opfer bringen, als Ersatz für zwei Umzüge durch die Felder eine Nacht im Klostergarten zubringen. „Ich setze in die Barmherzigkeit eures Schutzheiligen das Vertrauen, daß nach Abhaltung eines solchen Umzugs die Feldfrüchte reichlich gedeihen, daß der Schade, den schlechtes Wetter nach sich zieht, dadurch abgewehrt wird.“
- ↑ Vergl. Aus der Heimat, 1889 Nr. 43. Der Bauersberg und der Gesundbrunnen bei Trebra.
- ↑ Manche Orte, wie z. B. Petersdorf, übten mit der Feuerspritze am 3. Ostertage und am 3. Kirmeßtage.
- ↑ Quaste, Queste — Laubbüschel, ndl. Kwast = Bürste, dän. Kost = Reisigbaum. anord. Koister = Zweig. Vergl. Kluge, Deutsches etymol. Wörterbuch. — Gerade in unserer Heimat auf den trockenen Gipsen des Südharzrandes kommen die Questen, die Maquis, wie sie in Südeuropa heißt, häufig vor.
- ↑ K. Th. Weigel, Lebendige Vorzeit rechts und links der Landstraße. Berlin, 1934, 53. — Im Zusammenhang hiermit deutet Weigel sogar den Strauß, den die Knaben beim Johannisfeuer im Harze tragen als Quaste und als Phallussymbol und ähnlich das Kränzlein der Mädchen. — Fr. Schmidt, die Wahrheit über Questenberg, Questensest und Ouestenburg, Sangerh. Zeitung 1925, 38—44. — Fr. Schmidt, der Kreis Sangerhausen, Heft II, 3 ff. Hier auch erschöpfende Literaturangaben.
- ↑ Hahne, Vom deutschen Jahreslauf und Brauch, 48.
- ↑ E. Wiechert, die Majorin, Langen, 1935, 151.
- ↑ Weigel sieht auch in diesem artigen Brauchtum den Ueberrest eines alten Phalluskults. Weigel, a. a. O., 53 f. Vergl. die Fontinalia der Römer am 13. Oktober, bei denen man auch Blumen in die Quellen wars. — Daß Fruchtbarkeitskulte die Geschichte der Germanen von den ältesten Zeiten bis an die Wende zum Christentum begleitet haben, steht außer Frage. Die Felsbilder der Bronzezeit ebenso wie Adams v. Bremen Berichte über Upsala reden eine zu deutliche Sprache. Hier soll nur abgelehnt werden, daß jedes harmlose Symbol mit dem Phalluskult in Zusammenhang gebracht wird.
- ↑ Hahne versucht mit allem Vorbehalt eine uns nicht einleuchtende Deutung: Das Schaukeln der Mädchen hängt vielleicht mit dem uralten Bilde des Schaukelns, richtiger Umschwingens der Himmelsräume (?) zusammen. Hahne, a. a. O., 44.
- ↑ Ueber den Kornbock vergl. Mannhardt, Antike Wald- und Feldkulte, II, 156 ff. Ebenso Mannhardt II, 318 ff. viele Beispiele, wie allgemein verbreitet der Glaube durch ganz Europa war: In der Bourgogne, le loup est dans les blés. Die Kinder warnt man in der Champagne:Le loup vous mangera. Bei den Esten: hunt istub ruggis, der Wolf sitzt im Korn. — Dazu die römischen Hirci Sorani.
- ↑ Roggen und Weizen 8 Tage vor oder 8 Tage nach Michaelis, Flachs am 100. Tage nach Epiphanias.
- ↑ Loren; und Bartholomäus sind Wetterlage: Sind Loren; und Bartholomäus schön, Ist guter Herbst vorauszusehen. — Wie sich Bartholomäus hält, Ist der gan;e Herbst bestellt.
- ↑ Die Feierlichkeit der Aussaat hat schön gefühlt C. F Meyer in seinem Gedichte „Der Ulli“: „Gelassen schreitet dort im Aehrenfeld Ein rüst'ger Mann, der späte Saat bestellt. Schön ist ein jedes Werk das Jahr entlang, Am liebsten ist mir doch des Säers Gang. Mein wackrer Albrecht Dürer mal mir heut' Den lieben Heiland, wie er Körner streut.“ — Und dem kleinen Ulli Zwingli, der mit dem Vater zum ersten Male vom Hochgebirge herabgekommen und noch nie Bauers Arbeit gesehen, treten die Tränen ins Auge: „Was ist Dir, Ulli? Weinst Du? Schäme Dich!“ „Ei, Vater, es ist gar so feierlich.“
- ↑ Mannhardt, a. a. O., 162 f.
- ↑ Vergl. Herrmann, Altdeutsche Kultgebräuche, Diederichs, 1928, 10.
- ↑ In seltener Klarheit läßt sich bei Wote die Entwicklung der Gottheit erkennen. Steinzeitlich ist u. E. zunächst ein Dämon vorhanden, in den der Leib eines Toten eingegangen ist. Bronzezeitlich und früheisenzeitlich ist Wote der Führer des durch die Lüfte brausenden Totenheeres. In der späteren Eisenzeit wird er, und zwar nach unserer Ansicht in den schweren Kämpfen der istväonischen Germanen mit den Kelten, zum Anführer dsr auf der Walstatt gefallenen Helden. Tacitus kennt ihn schon als eine der hervorragendsten Gottheiten der Germanen; er nennt ihn Merkur. Noch später erscheint die Vorstellung von Wotan als Allvater, der mit den toten Recken zecht und seine Walkürien aussendet, die Helden, und gerade die tapfersten, ihm zuzuführen, damit sie ihm beistehn im letzten Kampf um die Herrschaft der Welt. Als solcher erobert er sich die ganze germanische Welt in den Stürmen der Völkerwanderung und der noch späteren Wikingerzeit. Der westgermanische Wodan wird der nordgermanische Odin. Im Volke aber bleibt durch die Jahrtausende die Vorstellung von dem Dämon lebendig, in den der Geist eines Toten eingegangen ist, der deshalb im Haus, im Feld, im Wald mit den Bewohnern lebt, aus das Wetter und damit auf das Gedeihen der Frucht Einfluß hat und am Himmel als Anführer der wilden Jagd daherfährt. Seine Gestalt als Totenfürst ist bis aus unsere Zeit lebendig: Der Tod dargestellt mit weitem Mantel oder Tuch, der Hackelberndt oder Hackelberg, und mit dem breiten Hute auf dem Totenschädel. Ohne daß daraus zu weitgehende Schlöffe gezogen werden sollen, mag doch darauf hingewiesen werden, daß uralte Volksvorstellungen vom Anführer des wilden Totenheeres von Persönlichkeiten der Heldensage übernommen worden sind. Der finstere einäugige Hagen, ursprünglich ein Nachtdämon, bewährt sich als Totenfürst. Derselbe Hagen tritt in der Hilde-Gudrunsage auf, in der das Motiv vom ewig erneuten Kampf, der Geisterschlacht, erscheint. Das Christentum hat sich den im Volke immer lebendigen Glauben von Wotan als Anführer der wilden Jagd zunutze gemacht und den großen Gott zu einem mit Schandtaten beladenen Geist umgedeutet, dem der Kopf bei seinen wilden Nachtritten nach hinten steht. Aehnlich wie schon in heidnisch-germanischer Zeit Wote zusammengeflossen zu sein scheint mit dem Hagen der Nibelungen- und Hildesage, so in christlicher Zeit mit Dietrich von Bern. Der große gute Gotenkönig Theoderich, der ein arianischer Ketzer ist, wird durch den Einfluß der katholischen Kirche zum Anführer der wilden Jagd, d. h. zu Wotan. Wie lebhaft die Vorstellung von diesem Dämon im Volke ist, erscheint noch darin, daß Familien seinen Namen tragen, in unserer Gegend z. B. die Hackelbergs und die Wüstemanns. Hierzu vergl. Silberborth, Heimatsagen, 13 ff.
- ↑ Nach Mannhardt, dem wir uns nicht anschließen können, bedeutet das Binden des Fremden, der am Felde vorübergeht oder dasselbe betritt, das Binden des Pflanzengeistes.
- ↑ Die abgeschlagenen Räume zu beiden Seiten der Tenne nennt man Schutz. War ein Schutz ausgedroschen, erhielten die Drescher eine Mahlzeit, das Schutzspiel.
- ↑ Michaelis ist Wettertag: Ist die Nacht von Michael recht hell, Kommt ein Winter kalt zur Stell. — Zu Michaelis Windwechsel bringt milden Winter.
- ↑ Michel steck' das Licht an, Das Gesinde muß zum Spinnen gahn.
- ↑ Vergl. Richwien, Eichsfelder Tageblatt, 1934, 6. November, Altgermanisches Brauchtum auf einer eichsfeldischen Kirmes. Hier über das „Reinigen des Kirmesangers“.
- ↑ Hakel = Haken, dann übertragen der Mantel, der mit dem Haken auf der Schulter befestigt wird. „Berndt“ ist der Träger, (bern = tragen; vergl. gebären, Börde, Bürde.) — Ueber den schützenden Mantel Wotans — St. Martins — vergl. Aus der Heimat, 1888, Nr. 26.
- ↑ Hahne, a. a. O., 68 gibt an, die Bevölkerung glaube umgekehrt bei dunklem Gansbrustbeine an einen kalten Winter. Er versucht auch eine Erklärung. — Martini ist Wettertag: Gehen Martini die Gänse aufs Eis, gehen sie Weihnachten in den Dreck.
- ↑ Kolbe, Heimatland, XI., 1915, 23 ff.
- ↑ In anderen Gegenden Deutschlands wird der Brauch am 4. Dezember, dem Barbaratag geübt. Danach das Gedicht von Hans Carossa,Barbaratag: Kirschenzweige bringt ein Mädchen Ueber kahle, kalte Heide. Dämmertag versinkt in Dunkel, Dörflein blinkt im Lustgeschmeide. Leise Stimme singt in Lüften: Dunkle Reiser, nicht vergebens Von dem Baum seid ihr gebrochen, Freut euch kurzen seligen Lebens. In der Weihnacht, in der finstern, Der sonst alle Blumen fehlen, Sollt ihr blühn mit weißen Sternen, Freude wecken bangen Seelen. Letztes Rot verlischt im Walde. Ton in Lüften bebt entschwindend. Ueber die verhüllte Heide Haucht der Bergwind, Schnee verkündend.
- ↑ Vergl. überall in unserer Heimat der Ausdruck Ruppert für einen ungeschlachten Menschen, ein Rauhbein. — Mannhardt, a. a. O., 186 f. erklärt den Knecht Ruprecht nur als Vegetationsdämon. Auch er lehnt Kuhns Erklärung Ruprecht-Hruodperaht ab. Vergl. Kühn Z. f. deutsches Altert. V, 482 ff.
- ↑ Hie und da in unserer Heimat, z. B. in Uthleben hat man Andreasbrauch und Nikolausbrauch miteinander in Verbindung gebracht. In llthleben ziehen am Andreastage die älteren Knaben und Mädchen verkleidet herum und erbitten von den Kindern Gaben; am Nikolaustage erscheinen sie wieder und beschenken umgekehrt die Kinder mit Aepfeln, Pfeffernüssen, Honigkuchen.
- ↑ Althochdeutsch: Zu wihen nahten = in den geweihten Nächten.
- ↑ Der römische Landmann stellte bei Beginn der Aussaat dem Iuppiter einen Imbiß hin, daher Juppiter dapalis oder Juppiter Epulo.
- ↑ Kossinna, die Deutsche Vorgeschichte eine hervorragend nationale Wissenschaft, Leipzig^6, 1934, 84, Abbildung 189.
- ↑ Kossinna, a. a. O., 85, Abbildung 190. — Ganz ähnliche Bedeutung kommt dem großen Gott mit dem Hammer zu, auch einer Licht- und Fruchtbarkeitsgottheit, aus der sich später wohl Donar herausgebildet hat.
- ↑ Caesar, de bello Gallico, VI. 21. Nam neque druides habent; qui rebus divinis praesint, neque sacrificiis student.
- ↑ Auch die jüngsten Aeußerungen über das Weihnachtsfest wie die von Dörries halten u. E. die zwei verschiedenen Schichten nicht genügend auseinander. Der Wotan-Hollekult gehört einer dritten Schicht an; der Fruchtbar- keitskult, der spätere Donar-Freyr-Kult, ist einer früheren, zweiten Schicht zuzuweisen. Vergl. Dörries, Germanische Religion und Sachsenbekehrung, Göttingen, Vandenhoeä?, 1935.
- ↑ Das Thüringer Schiedchen gehört zum Verbum scheiden, spalten. Die niederdeutsche Klöwe zum Verbum, klauben, spalten. Sonst sagt man in weiten Teilen Norddeutschlands Stolle, in unserer Heimat Weck.
- ↑ Die Römer feierten am 15. Februar das Fest der Lupercalien. Dabei liefen die Luperci, nur mit einem Schurz bekleidet, durch die Straßen und schlugen die ihnen begegnenden Frauen mit Riemen, um ihnen Fruchtbarkeit zu verleihen. Vergl. auch Aus der Heimat, 1891,52 und 1892,1. — Daß das Kindeln auch in weiten Gebieten Frankreichs üblich war, beweist die 45. Erzählung des berühmten Heptamerons der Margarete von Navarra, wo der Brauch aus der Gegend von Tour bezeugt wird. Auch hier wird das Kindeln aus den Bethlem. Kindermord zurückgeführt.
- ↑ altnord. hvel, angels. hveol, friesisch yule = Rad. engl. pule = Weihnachten, vergl. auch got. jiuleis, altnord. yler mit Jenner, Januar.
- ↑ Neujahrssingen von Erwachsenen wurde in Nordhausen 1800 verboten, weil es zu lästiger Bettelei ausartete. Die arme Bevölkerung einiger hochgelegener Harzorte, z. B. Schierkes, hat die Sitte noch weit ins 19. Jahrhundert beibehalten, zur Neujahrszeit ihre Leute in die das Gebirge umgebenden Ebenen zu Bittgängen zu schicken.
- ↑ Vergl. Wille, Heimatland III, 123 f. — In der Aue und in der Grafschaft heißt es: Ich bin einer kleiner König, Gebt mir nicht zu wenig;
Laßt mich nicht zu lange stehn, Ich muß noch ein Haus weiter gehn. - ↑ Vergl. Kolbe, Heimatland III, 53 f.
- ↑ Vergl. E. Troeltsch, Gesammelte Schriften, III, Der Historismus und seine Probleme, 2. Hälfte, 772. — Cervantes, Don Ouijote VII, 3. Die Historie ist eine fast heilige Sache, und wo die Wahrheit ist, ist das Göttliche in der Wahrheit. (Nach der Uebersetzung von Ludwig Tieck.)
